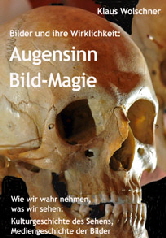|
|
|
|
|
|
FAZ 22.9.2010 Von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer
Im Netz Computer, Satellitenfernsehen, Spielekonsolen und Smartphones verändern unser Leben. Etwa fünfeinhalb Stunden am Tag verbringen Jugendliche in Deutschland heute im Durchschnitt mit digitalen Medien. Digitale Medien wie Computer, Satellitenfernsehen, Spielekonsolen und Smartphones verändern unser Leben. In den Vereinigten Staaten verbringen Jugendliche mittlerweile etwa 7,5 Stunden am Tag mit digitalen Medien - mehr Zeit als mit Schlafen. Hierzulande verschlingt die Beschäftigung mit diesen Medien etwa 5,5 Stunden täglich; das ist mehr als der Unterricht in der Schule, der, auf die ganze Woche bezogen, im Durchschnitt knapp vier Stunden in Anspruch nimmt. Was hat das zu bedeuten? Der Publizist Nicolas Carr beschreibt die subjektiv erlebten Folgen des Internetgebrauchs wie folgt: "Das Netz scheint meine Fähigkeit zur Konzentration und zur Kontemplation zu zerstören. Mein Geist erwartet, Informationen in genau der Weise aufzunehmen, wie sie im Netz geliefert werden: in Form eines rasch bewegten Stroms kleiner Teilchen . . . Meine Freunde sagen dasselbe: Je mehr sie das Netz benutzen, desto mehr müssen sie kämpfen, um sich auf das Schreiben längerer Abschnitte zu konzentrieren." Und so schildert ein 17 Jahre alter Jugendlicher in einer amerikanischen Studie über den Medienkonsum seinen Alltag: "Jede Sekunde, die ich online verbringe, bin ich am Multitasken. Jetzt gerade schaue ich fern, checke meine E-Mails alle zwei Minuten, lese Nachrichten darüber, wer Kennedy erschoss, brenne Musik auf eine CD und schreibe diese Nachricht." Die Mutter eines 15 Jahre alten Jungen entwirft von der Vorbereitung ihres Sohnes auf eine Klassenarbeit folgendes Bild: "Die Lehrbücher lagen ungeöffnet in seiner Tasche, wohingegen der Laptop auf seinem Schreibtisch immer aufgeklappt war. Auf dem Bildschirm war irgendwelche Geschichte/Englisch/Physik-Dokumente geöffnet, aber gleichzeitig auch seine Facebook- und iTunes-Seiten. In seinen Ohren spielten die iPod-Ohrhörer einen Podcast, und manchmal, nur um seine Konzentration noch weiter zu unterbrechen, lief auch noch ein Video auf Youtube." Für das digitale Zeitalter ist es charakteristisch, dass viele Menschen fast ihre gesamte wache Zeit online verbringen; sie werden also permanent mit neuen Texten und Bildern konfrontiert. Die Auswirkungen dieser digitalen Revolution auf Bildungsprozesse wurden von vielen zunächst ausschließlich positiv beurteilt. Wie vor einem halben Jahrhundert bei der Verbreitung des Fernsehens als Massenkommunikationsmittel hieß es, der ungehinderte Zugang zu Informationsquellen eröffne grenzenlose Bildungschancen für alle - und wurde daher als ungeahnter psychologischer, sozialer und ökonomischer Fortschritt dargestellt. Im Hinblick auf das Fernsehen weiß man aber längst, dass diese Bildungsrevolution nicht stattgefunden hat. Im Gegenteil: Je höher der Fernsehkonsum, desto geringer die Bildung. Nach allem, was bisher bekannt ist, verhält es sich mit den digitalen Medien ähnlich: Eine besondere Auswertung von Daten der Pisa-Studie hat ergeben, dass ein Computer zu Hause bei 15 Jahre alten Heranwachsenden mit schlechteren Schulleistungen einhergeht. Aus einer anderen Untersuchung geht hervor, dass eine Spielekonsole ("Playstation") schon nach vier Monaten dazu führt, dass die Leistungen in der Schule sinken und die Probleme zunehmen. Die Auswirkungen der digitalen Revolution lassen sich aber nicht nur mit Erfahrungsberichten und empirischen Studien erfassen. Auch die Gehirnforschung kommt zu Ergebnissen, die Aufmerksamkeit verdienen. Die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurobiologie lautet, dass sich das Gehirn durch seinen Gebrauch permanent verändert. Jedes Wahrnehmen, Denken, Erleben, Fühlen und Handeln hinterlässt Spuren, die man seit mehr als einhundert Jahren auch so nennt: Gedächtnisspuren. Bis in die achtziger Jahre hinein nur hypothetische Gebilde, sind sie heute jedoch sichtbar zu machen. Denn Synapsen, also jene Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, über welche die elektrischen Signale laufen, mit denen das Gehirn arbeitet, können mittlerweile fotografiert und sogar gefilmt werden. Man kann zusehen, wie sie sich bei Lernprozessen verändern. Werden funktionelle bildgebende Verfahren eingesetzt, dann lässt sich sogar die Aktivität ganzer Bereiche des Gehirns sichtbar machen. So kann man die neuronalen Auswirkungen von Lernprozessen gleichsam im großen Stil nachweisen. Wenn nun aber das Gehirn immer lernt - denn eines kann es nicht: nicht lernen -, dann hinterlässt dort auch die mit digitalen Medien verbrachte Zeit ihre Spuren. Doch welche? Unser Gehirn ist das Produkt der Evolution, es entstand während eines langen Zeitraums durch Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen. Die digitalen Medien gehörten aber nicht dazu. So wie man heute viele Zivilisationskrankheiten als Ausdruck eines Missverhältnisses zwischen der früheren Lebensweise - Jagen und Sammeln mit viel Bewegung und ballaststoffreiche Nahrung - und dem modernem Lebensstil - mit wenig Bewegung und ballaststoffarmer Nahrung - versteht, sind auch die negativen Auswirkungen der digitalen Medien auf geistig-seelische Prozesse im evolutions- und neurobiologischen Rahmen besser zu erfassen. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Mechanismen und Prozesse beschreiben, die kognitive Leistungen wie die Aufmerksamkeit oder die Entwicklung von Sprache und Intelligenz betreffen und sich in der Summe auf die Bildung eines Menschen auswirken. Hinzu kommen die Einflüsse des Medienkonsums auf emotionale und soziale psychische Prozesse bis hin zu ethisch-moralischen Einstellungen und unserer Sicht auf uns selbst, also auf unsere personale Identität. Bis zu einem Alter von zwei bis drei Jahren können Kinder von Bildschirmen und Lautsprechern nichts lernen, wie entsprechende Studien belegen. In Kalifornien konnten neun bis elf Monate alte Säuglinge chinesische Laute von einer Chinesin lernen, die ihnen vorlas. Wenn sie dieselbe Chinesin auf CD oder Video hörten oder sahen, lernten sie jedoch nichts. Säuglinge brauchen den sozialen Kontakt und eine Stimulation über alle Sinne, was zudem räumlich und zeitlich genau zusammenpassen muss: Genau dann und dort, wo sich zwei Gläser berühren, macht es "ping!" Wenn das Geräusch auch nur fünf Millisekunden zu früh oder zu spät kommt, kann das Kind beide Sinneseindrücke nicht zusammenbringen und lernt somit nicht, was es heißt, wenn sich zwei Objekte aus Glas berühren. Kleine Kinder lernen - das abgedroschene Wort muss hier genannt werden, weil kein anderes so gut passt - ganzheitlich. Was geschieht, wenn dies nicht beachtet wird, erfuhr jüngst schmerzhaft der Disney-Konzern: Seit dem Jahr 2003 vertrieb er mit großem Erfolg DVDs mit der Bezeichnung "Baby Einstein". In der Werbung hieß es, damit werde sich ein Baby bei täglichem Konsum zum Sprachgenie entwickeln. Tatsächlich kam eine große Studie amerikanischer Kinderärzte mit mehr als tausend Säuglingen 2007 zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Baby-Einstein-DVDs auf die Sprachentwicklung der Kleinen einen doppelt so negativen Effekt hatte, wie sich tägliches Vorlesen hierauf positiv auswirkte. Im Licht der Chinesisch lernenden Säuglinge an der amerikanischen Westküste ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich: Babys verbringen die meiste Zeit mit Schlafen und sehr viel ihrer wachen Zeit mit Essen, Windelnwechseln und anderen Notwendigkeiten. Wenn sie nun schon einmal - was gar nicht so oft vorkommt - wach, guter Dinge und somit aufnahmefähig sind, aber genau in dieser Zeit vor den DVD-Spieler gesetzt werden, von dem sie ja nichts lernen können, dann geht eben wichtige Zeit für Lernprozesse verloren, und die intellektuelle Entwicklung leidet. Angemerkt sei, dass der Disney-Konzern zunächst zwei Jahre lang versuchte, die Ergebnisse der vernichtenden Baby-Einstein-Studie zu unterdrücken. Seit dem Herbst vergangenen Jahres nimmt er die DVDs bei Erstattung des vollen Kaufpreises aber selbst dann zurück, wenn man keinen Kaufbeleg mehr besitzt. Der Grund: Tausende Eltern verklagen den Konzern nun wegen Schädigung der Bildungsbiographie ihrer Kinder. Denn die Sprachentwicklung ist der Grundpfeiler der kognitiven Entwicklung schlechthin, und deren Beeinträchtigung kann über eine spätere Schul- und Hochschullaufbahn entscheiden, die sich, auf die Lebenszeit umgerechnet, auf Einkommenschancen in Millionenhöhe auswirkt. Baby Einstein könnte für den Konzern also noch sehr teuer werden. Das ganzheitliche Lernen ist aber nicht nur für Kinder wichtig. Auch Erwachsene lernen mit Herz, Hirn und Hand. Das sagte im 18. Jahrhundert schon der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi. Die moderne Gehirnforschung kann seine Intuition auf eindrucksvolle Weise belegen. Wenn dieselben, zuvor unbekannten Gegenstände neu zu lernen sind und entweder durch Betrachten und bloßes Zeigen oder durch Betrachten und gleichzeitiges Ausführen einer sinnvollen, zum Gegenstand passenden Bewegung gelernt werden, kann man hinterher viel besser über sie nachdenken, wenn sie auf die zweite Art gelernt wurden. Etwa ein Drittel unseres Gehirns ist für die Planung, Koordination und Ausführung von Bewegungen zuständig, und genau dieses Drittel wird beim Lernen mit der Hand benutzt. Beim Lernen mit einem Mausklick, einer bloßen Zeigebewegung, bleibt dieses Drittel passiv. Wer sich also die Welt am Bildschirm aneignet, der hat sie sich vergleichsweise oberflächlicher angeeignet und rekrutiert beim Nachdenken über sie deutlich weniger Nervenzellen. Kleine Kinder können spätestens im Alter von drei Jahren vom Bildschirm lernen. Dieser Befund hat vor allem die Werbewirtschaft auf den Plan gerufen. Experimente mit Kindern im Vorschulalter zeigten, dass diese den Inhalt von Werbespots nach nur wenigen Darbietungen gelernt hatten und das Produkt auswählten. Weil in den Vereinigten Staaten die Kinder im Alter von durchschnittlich neun Monaten beginnen fernzusehen und im Vorschulalter im Durchschnitt 1,5 Stunden am Tag Medien ausgesetzt sind, hat das Trommelfeuer der Werbung unter anderem zur Folge, dass ein Kind beim Eintritt in die Schule mehr als 200 Markennamen kennt. Etwa 65 Prozent der Werbung, die an Kinder gerichtet ist, gelten Nahrungsmitteln, die wiederum zu hundert Prozent ungesund sind. Die Folge ist eine epidemieartige Zunahme von Fettleibigkeit und sogar Altersdiabetes bei Kindern und Jugendlichen. Die Neurobiologie des Essverhaltens zeigt zudem, dass eine "westliche", kalorienreiche Ernährungsweise ähnlich wie Suchtstoffe (Nikotin, Amphetamin, Kokain) die Empfindlichkeit des gehirneigenen Belohnungssystems vermindert. Es muss daher immer mehr konsumiert werden, um denselben belohnenden Effekt zu erzielen. Der medial verursachte Dauerkonsum der Kinder von Zucker und Fett entspricht aus neurobiologischer Sicht dem "Anfixen" mit Rauschgift. Allerdings normalisiert sich das Belohnungssystem nach dem Absetzen etwa von Amphetamin deutlich schneller als nach dem Verzicht auf Käsekuchen und Pommes frites. Mit Hilfe der Medien wird somit ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der allein in Deutschland vorsichtig geschätzt jährlich 20 000 Tote und zehn bis fünfzehn Milliarden Euro Gesundheitskosten verursacht. Die negativen Auswirkungen der Medien auf den Körper werden nur noch von einem übertroffen: den negativen Effekten auf den Geist, nimmt man die Auswirkungen auf die kognitiven, emotionalen und personalen Prozesse zusammen. Beginnen wir mit der Bildung. Schule wird von Schülern nicht selten als bestenfalls langweilig erlebt. Verglichen mit der Zeit, die nachmittags an Konsolen, Computern und Bildschirmen verbracht wird, ist der Unterricht am Vormittag langweilig. Weil aber Emotionen für Lernprozesse wichtig sind, wird in der Schule nur wenig gelernt. Es kommt hinzu, dass gerade Gelerntes stets verfestigt werden muss, um dauerhaft im Gedächtnis verankert zu sein. Dieser Prozess, Konsolidierung genannt,kann durch Emotionen gestört werden. Wenn also vormittags im Französisch- oder Physikunterricht gelangweilt wenig gelernt worden ist, dann sorgt der Umgang mit der Playstation am Nachmittag dafür, dass das wenige, das am Vormittag dennoch hängenblieb, regelrecht gelöscht wird. Die permanente "Online-Existenz" wirkt sich zusätzlich negativ aus: Zur Konsolidierung des Gelernten braucht das Gehirn Zeiten der Ruhe. Das kann ein kurzer Mittagsschlaf sein, muss es aber nicht: Dösen, an die Decke starren, die Gedanken einfach treibenlassen und eben nicht Reize von außen verarbeiten - darauf kommt es an. Genau das wird aber durch ein Leben "online" verhindert. Immer mehr Zeitgenossen sind dauernd mit der ganzen Welt verbunden, aber um den Preis, dass sie sich immer weniger wirklich mit ihr auseinandersetzen, weil sie immer weniger dazu fähig sind. Ein besonders eindringliches Beispiel für die Art und Weise, wie einem die Welt abhandenkommen kann, ist das sogenannte mediale Multitasken. Dieses gleichzeitige Bearbeiten mehrerer Aufgaben und das oft damit verbundene gleichzeitige Benutzen mehrerer Medien spielt im Leben vieler junger Menschen eine wichtige Rolle. Nur wenige, etwa fünfzehn Prozent, betreiben so gut wie kein Multitasking. Die tägliche Medienkonsumzeit der häufigen Multitasker beträgt indes 12,5 Stunden, und das hineingepackt in acht bis neun Zeitstunden. Denkt diese Generation der Medienmultitasker tatsächlich anders, schneller und effektiver, wie manche Medienpädagogen behaupten? Da jede geistige Aktivität im Gehirn Spuren hinterlässt, die seine zukünftige Funktion beeinflussen, muss angenommen werden, dass Multitasking tatsächlich das Denken verändert. Diese Änderungen könnten positiv sein: Man wächst schließlich mit den Aufgaben. Der Einfluss könnte aber auch negativ sein, denn "zwei Dinge gleichzeitig tun bedeutet, beide nicht zu tun", wie es in den Sentenzen des römischen Sklaven Publilius Syrus aus dem ersten Jahrhundert vor Christus heißt. Was trifft nun zu? Um diese Frage zu klären, führten Wissenschaftler von der Universität Stanford mit zwei Gruppen von Versuchspersonen Tests durch: 19 heftigen Medienmultitaskern und 22 Nicht-Medienmultitaskern. Mit einer "Filteraufgabe", bei der unterschiedliche ablenkende Reize auszublenden waren, wurde die Fähigkeit der Versuchspersonen getestet, unwichtige Reize nicht zu beachten. Zwischen beiden Gruppen zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Die Nicht-Multitasker konnten die Aufgabe gut lösen, unabhängig davon, wie viele zusätzliche Reize vorhanden waren. Bei den Multitaskern hingegen ging die Leistung mit der zunehmenden Anzahl ablenkender Reize zurück. Weitere Aufgaben zeigten, dass auch innere Reize, etwa Gedanken, die für die Aufgabe unwichtig waren, von den Multitaskern schlechter ausgeblendet werden konnten. Und zu guter Letzt ließ sich nachweisen, dass es Multitaskern sogar viel schwerer fiel als Nicht-Multitaskern, zwischen zwei Aufgaben zu wechseln. Diese Versuche zeigen, dass Menschen, die häufig mehrere Medien gleichzeitig benutzen, Probleme mit der Kontrolle ihres Denkens haben: Sie können unwichtige äußere Reize schlechter ausblenden und auch Unwichtiges in ihrem Gedächtnis schlechter ausblenden. Besonders bedeutsam ist, dass Multitasker keineswegs besser zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln können. Im Gegenteil, sie können es weniger gut. Mit anderen Worten: Wer noch nicht unter einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, der kann sie sich durch häufiges Multitasking antrainieren. Mediales Multitasking ist daher nichts, wozu man die nächste Generation ermuntern oder was man gar durch Bildungsreformen fördern sollte. Und weder die Gesellschaft noch die Wirtschaft sollten daran ein Interesse haben. Jonathan B. Spira von der Unternehmensberatungsfirma Basex schätzte die Kosten des Multitasking in der Arbeitswelt schon vor drei Jahren auf etwa 650 Milliarden Dollar. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass Angestellte fast 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verschiedensten Unterbrechungen widmen und danach versuchen, sich wieder auf eine angefangene Arbeit zu konzentrieren. Dass Oberflächlichkeit und Ineffektivität durch die gleichzeitige Benutzung mehrerer Medien eingeübt werden, legt auch eine Studie von Wissenschaftlern des University College in London über die Nutzungsgewohnheiten der Online-Bibliothekskataloge nahe: Junge Menschen hüpften von Inhalt zu Inhalt und kehrten praktisch nie zu einem Inhalt zurück. Bei einem wie auch immer gearteten methodischen Vorgehen (man denke an den hermeneutischen Zirkel) wäre genau das aufgrund des sich einstellenden vertieften Verständnisses jedoch zu erwarten. Nicht nur besorgte Eltern äußern Betroffenheit, Unmut und Frustration angesichts der Auswirkungen digitaler Medien. Auch Wissenschaftler und sogar Internetfachleute werden zunehmend skeptisch. Marianne Wolf, Professorin für kindliche Entwicklung mit dem Forschungsschwerpunkt Legasthenie an der Tufts University in Boston, äußert in ihrem Buch "Proust and the Squid" (deutscher Titel: "Das lesende Gehirn") kritische Gedanken über die Veränderungen durch digitale Medien in den Gehirnen der Nutzer und gibt zu bedenken, dass "mehr" und "schneller" nicht unbedingt "besser" bedeute. Der Internetveteran und Miterfinder der virtuellen Realität Jaron Lanier stellt in seinem Buch "You are not a gadget" (wörtlich etwa: Du bist kein Spielzeug) die negativen Folgen der Anonymität des Internets für die Identitätsbildung der Nutzer heraus: Schwarmintelligenz (hivemind) verkommt seiner Meinung nach sehr rasch zur Pöbelherrschaft (mobrule). Wie zum Beleg erreichen den Autor dieser Zeilen nicht selten E-Mails mit Inhalten wie dem folgenden: "Herr Spitzer, ich spiele hier gerade mit einer virtuellen Kalaschnikow. Wenn ich eine reale hätte, wären Sie der Erste, den ich umnieten würde. PS: Was Sie über den Zusammenhang zwischen virtueller Gewalt und realer Gewalt sagen, ist vollkommener Unsinn." Oberflächlich betrachtet, scheinen viele der genannten Beobachtungen nichts mit Gehirnforschung zu tun zu haben. Tatsächlich zeigen die angeführten Beispiele jedoch, dass die Gehirnforschung wesentlich zum Verständnis der Folgen der "Digitalisierung" für die Lebenswelt beitragen kann. Damit hält sie auch den Schlüssel zur Lösung der mit der Digitalisierung verbundenen Probleme und vor allem zu einem vernünftigen, fruchtbringenden Umgang mit digitalen Medien bereit. Werden Referate in Schulen mittels Powerpoint gehalten, sind sie nicht automatisch besser. Es besteht vielmehr das Risiko, dass Inhalte gar nicht mehr wirklich geistig bearbeitet werden. Wenn Texte nicht mehr gelesen, sondern "oberflächlich abgeschöpft" (geskimmt) werden, wenn "auf Wellen geritten" (gesurft) wird, anstatt Gedanken und Ideen in Büchern und Bibliotheken aufzusuchen, wenn das Aufschreiben eines Gedankens durch "Kopieren" (copy) und "Einfügen" (paste) per Mausklick ersetzt wird, dann wird dadurch niemand intelligenter. Dasselbe gilt für das sogenannte E-Learning. Man hat vielmehr einsehen müssen, dass es schlechterdings nicht funktioniert. Das wird jedoch nicht etwa zähneknirschend eingestanden, sondern rasch das Zeitalter des "blended learning" ausgerufen. "To blend" heißt "mischen"; und dem Lernen hinzuzumischen sei also, damit es wirklich funktioniere, der Lehrer. Die sprachliche Arroganz, mit der hier unabdingbare Faktoren wie menschliche Zuwendung und gegenseitige Wertschätzung durch die Hintertür in den Lernprozess wiedereingeführt werden, ist kaum zu überbieten. Jugendliche haben zunehmend Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, etwas zu lesen und zu verstehen oder gar einen zusammenhängenden Text zu Papier zu bringen. Ihre Fähigkeit zur Konzentration und zur Versprachlichung von Gedanken hat ebenso abgenommen wie ihre soziale Kompetenz. Denn zur Dummheit gesellt sich eine merkwürdige Dumpfheit. Viele Jugendliche wissen nicht mehr, wie man sich verhält und benimmt: Wenn zwei sich streiten, dann schreitet man nicht ein, sondern zückt das Handy und filmt das Ganze. Der Bundestag hat schon vor einigen Jahren darüber debattiert, dass sich im Allgäu - nicht in Berlin-Neukölln oder in Köln-Chorweiler - zehn bis zwölf Jahre alte Grund- und Hauptschulkinder auf dem Schulhof Hinrichtungsvideos per Bluetooth für fünf bis zehn Euro gegenseitig verkauften. Die allgemeine Verrohung ist nicht mehr nur ein Problem der Großstadtdschungel, sie hat längst den vermeintlich heilen ländlichen Raum erfasst. In den Vereinigten Staaten konnte man schon vor mehr als zehn Jahren erleben, dass Schulen nicht nur wie Gefängnisse aussehen können, sondern auch so bewacht werden; und dass man zur Einschulung einen Brief des Direktors erhält, in dem dieser darauf hinweist, dass es verboten sei, den Kindern Handfeuerwaffen mit in die Schule zu geben. "Macht Google uns dumm?" - So lautet der Titel eines 2008 publizierten und mittlerweile in Buchform vorliegenden Klassikers unter den medienkritischen Essays. Die Gehirnforschung kann zeigen, dass nicht etwa Google allein und nicht nur die Dummheit ein Grund zur Beunruhigung sind. Denn weil sich Gehirne mit der Benutzung ändern, kann die tägliche Nutzung digitaler Medien mit Sicherheit eines nicht haben: keinerlei Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Wenn man sich Mühe gäbe, gute Lernsoftware zu programmieren und an die Schulen zu bringen, wenn man sich darüber klar würde, dass mediale Gewalt zu mehr Gewalt in der realen Welt führt (der Zusammenhang ist etwa so stark wie der zwischen Rauchen und Lungenkrebs), wenn man die Dosis (die wie immer das Gift macht) beschränken würde - auf null für Kinder bis drei Jahre, auf höchstens eine Stunde am Tag für Schüler der Sekundarstufe II) - und wenn Medien niemals dazu verwendet würden, den Kontakt junger Menschen mit Erwachsenen oder anderen Kindern und Jugendlichen zu ersetzen, dann könnten digitale Medien durchaus ein Segen für die Gesellschaft sein. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist Vorsicht geboten. Wer etwas anderes behauptet, der trägt die Beweislast. Der Verfasser hat den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Ulm inne und leitet dort die Psychiatrische Universitätsklinik sowie das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL).
|