|
Was wir sehen:
Bilderflut, Bild-Konsum: Was machen Bilder mit uns?
Was machen wir mit Bildern?
Bilder waren gewissermaßen immer Trugbilder.
Bilder sind Medien der Generierung und Übertragung von Bedeutungen.
Phantasiereisen sind ein Sonntags-Vergnügen für den menschlichen Geist.
Die Zuweisung von Bedeutung ist ein Teil der Kultur – und unterliegt damit der Kulturgeschichte.
In der Kulturgeschichte des Sehens geht es um die Frage, wie Bilder
Sinn generieren und Aufmerksamkeit fesseln
2016
Das Bild, das wir zu sehen scheinen, ist in seiner physischen bzw. physikalischen Existenz ein Geflacker von Lichtreflexionen. Zum bedeutsamen Bild wird es erst durch die Interpretation der Lichtpunkte im Kopf.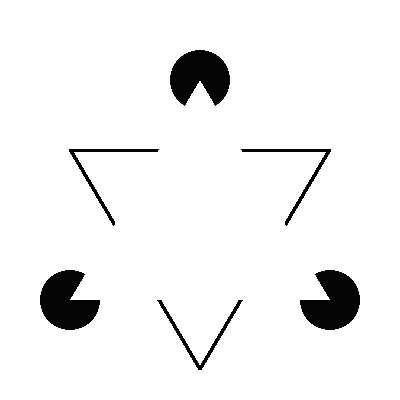 Sehen ist Praxis, Handeln: Das eigentliche Bild ist eine Projektion von Bedeutung auf die Lichtpunkte der Leinwand oder der physischen Natur. Sehen ist Praxis, Handeln: Das eigentliche Bild ist eine Projektion von Bedeutung auf die Lichtpunkte der Leinwand oder der physischen Natur.
Im modernen Verständnis ist alles, was sich dem Auge bietet, ein „Bild", und erscheint als Abbild, das die Augenlinse auf die Netzhaut projiziert. Das Gehirn muss nach diesem Verständnis nur noch das spiegelverkehrte Abbild auf die Füße stellen und schon ist das Objekt „gesehen“. Diese Vorstellung vom Sehen überträgt Modelle der technischen Optik und gipfelt in der Feststellung, dass das Auge, so Hermann von Helmholtz 1867, „im wesentlichen wie eine Camera obscura“ funktioniere, die ihre Zeichen an das Gehirn weiterleitet. Dieses Verständnis ist unzureichend und irreführend – schon deshalb, weil das Kamera-Abziehbild ein fixiertes Bild ist, eine Momentaufnahme, die ein erstarrtes Blickfeld festhält, einen Ausschnitt von vielleicht einem Sechszigstel einer Sekunde, mehr nicht. Solche erstarrten Bilder könnten nur verarmte Information liefern über die bedeutungsvolle menschliche Umwelt, die immer in Bewegung ist. Kein Tier könnte überleben, kein Mensch sich in seiner Umwelt orientieren, wenn das Gehirn seine überlebenswichtigen Informationen nur aus solchen erstarrten Abbildern ziehen könnte. Für das Gehirn ist ein natürliche Bild immer eine Momentaufnahme aus einem Film. Die Wahrnehmung von fixierten Momentaufnahmen ist künstliches Sehen, ein Ergebnis von Kulturgeschichte. Aber die eigentliche Frage an die moderne Gehirnforschung wäre zudem, wie das Gehirn die Lichtimpulse auf der Netzhaut elektrochemisch verarbeitet.
Sehen ist ein Ergebnis von Aktivität des Gehirns
Sehen bedeutet nicht einfach das Wahrnehmen des Sichtbaren. Das Auge nimmt kein Bild auf, sondern nur Lichtwellen. Weder auf der Netzhaut noch im Gehirn gibt es Bilder, auch keine symbolischen Repräsentationen, sondern nur kurzzeitig gebildete und sich sofort wieder auflösende komplexe Aktivierungen im Netzwerk der Synapsen. Das Gedächtnis gleicht die einkommenden Licht-Impulse ab mit den Mustern früherer Sinneseindrücke und ihren Interpretationen. Jedes Kind muss das begreifende „Sehen“ erst lernen, d.h. ein Bild-Gedächtnis anlegen, für das Erwachsene das sprachlich codieren, was vor Augen steht. Wir sehen eine Verkehrsampel, eine Uhr - das sind komplexe Produkte der Kulturgeschichte, die wir da „sehen”. 99 Prozent dessen, was wir „sehen”, stammt aus unserem Gedächtnis, sagt der Hirnforscher Gerhard Roth. Sehen ist kein individuelles Erlebnis. Natürlich kann die Welt „da draußen" nur durch die Brille der im sozialen System erzeugten Sinngehalte gelesen werden. Wir können nur das „sehen“, was unseren evolutionär und sozial vorgeformten Sehgewohnheiten entspricht.
Unser Bild-Gedächtnis wird aktiviert durch eine schnelle Abfolge eintreffender visueller Sinnesreize und verwandelt diese in statische Bild-Eindrücke, die stillhalten, damit wir sie in Ruhe „begreifen“, d.h. mit Inhalt aufladen können. Der substantivische Charakter der Sprache unterstützt die Wahrnehmung der „Bilder“ als statischer Objekte.
Nur zehn Prozent der Nervenverbindungen des Sehzentrums laufen zum Auge – 90 Prozent in die Gedächtnis-Regionen des Gehirns. Vor diesem Hintergrund wird der Effekt verständlich, dass wir eine Zehntelsekunde in die Zukunft sehen können (Mark Changizi). Wenn Licht auf die Netzhaut trifft, dauert es etwa eine Zehntelsekunde, bis das Signal dreidimensional umgerechnet und interpretierbar wird. Unser Gehirn versucht aber schneller, zu prognostizieren, was passieren könnte – etwa dass der Ball gegen unseren Kopf prallen wird. Wir reagieren. Wenn die Annahme falsch ist, nennen wir das „optische Illusion“.
Im natürlichen Normal-Fall bewegen sich die Augen im Kopf und es bewegt sich der Kopf auf dem Leib und es bewegt sich der Leib – der Mensch ist ein wackelnde Turm. Was vor den Augen erscheint sind also andauernd und chaotisch bewegte visuelle Umwelt-Anblicke. Mit einer Drehung des Kopfes können wir den gesamten Horizont an unseren Augen vorbeirasen lassen. Jedes sich freie bewegende Lebewesen muss permanent seine Umwelt mit dem Blick abscannen, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Diese Bilderflut „erscheint“ nicht einfach dem passiven Gehirn, sondern sie wird durch die Aktivität des aufmerksamen Gehirns, das die Bewegungen von Augen und Körper herausrechnet aus dem Seh-Eindruck, gesucht und „erfasst". Die antike Vorstellung von den Sehstrahlen, nach der der Mensch mit seinen Blick etwas auf das Objekt wirft, hat diese Aktivität plausibel empfunden.
Was sichtbar ist, unterliegt also einer spezifischen Ordnung des wahrnehmenden Blicks, mentalen Kategorien, die visuelle Erfahrungen organisieren und Sinn stiften. Bilder waren gewissermaßen immer Trugbilder. Bilder sind Medien der Generierung und Übertragung von Bedeutungen. Die Zuweisung von Bedeutung ist ein Teil der Kultur – und unterliegt damit der Kulturgeschichte. Im Übergang zu Kunstbildern und zu einer fotografischen, filmischen und schließlich computergenerierten Bild-Realität entstehen nur neue Bild-Träger mit neuen Techniken für „virtuelle“ Realitäten.
Aus diesem Reizfluss muss das Gehirn Informationen identifizieren, Konstanten fixieren, die für das Lebewesen Bedeutung haben und zur Voraussetzung von Handeln werden können. Die von der Netzhaut aufgenommenen Lichtsignale werden nicht einfach in Nervenzellsignale umwandelt, sondern bereits in der Netzhaut „vorsortiert“: Unterschiedliche Ganglienzellen reagieren auf die Eigenschaften der gesehenen Bilder, Informationen über Kontrast, Farbe, Bewegungsrichtung, die Lage von Kanten und ihrer Orientierung werden über getrennte Kanäle ans Gehirn weitergeleitet. Bei Mäusen konnten Tübinger Neurowissenschaftler bis zu 40 verschiedene Typen von Ganglienzellen in der Netzhaut unterscheiden. Aus dem grünen Rascheln im grünen Laub könnte die fixierte Information „Schlange“ entnommen werden und zum Signal für Fluchtreflexe werden. Es gehört zu der natürlichen Arbeit der visuellen Zentren im Gehirn, aus der Menge der „huschenden, zuckenden, zappelnden“ visuellen Informationen der bewegten Umwelt halbwegs bedeutsame und handlungsrelevante Informationen zu generieren.
Eine schnelle Kopfdrehung ist für ein rein optisches Verständnis des Auges kein Problem, aber für das visuelle System des Gehirns eine große Herausforderung. Kinder experimentieren mit den begrenzten Möglichkeiten des Gehirns, aus den vorbeihuschenden visuellen Reizen halbwegs klare Bilder zu konstruieren – das Karussell gehört zu den beliebten Spielzeugen dafür. Die Welt dreht sich scheinbar weiter, wenn das Karussell abrupt angehalten wird – einen Moment jedenfalls, bis das Gehirn sich daran gewöhnt hat, dass es nicht mehr versuchen muss, die Drehverwischungen herauszurechnen aus den visuellen Reizen der (optischen) Augenlinse.
Auch die Wahrnehmung „Bahnsteig fährt ab" beruht auf dieser Illusion: Das Gehirn nimmt die beginnende Bewegung des Zuges nicht wahr, da der Körper ruht, und interpretiert das vorbeiziehende Außenbild des Bahnsteigs als eigentliche Bewegung. Nach Bruchteilen einer Sekunde korrigiert das Gehirn diese Täuschung und errechnet selbstverständlich aus der Schnelligkeit der Verschiebungen des Augenbildes die eigene, am Leib kaum spürbare Geschwindigkeit.
Was den „natürlichen“ Film, der sich aufgrund der Körperbewegungen dem Gehirn als unendlich schnelle Bildfolge bietet, von dem Kino-Film mit seinen 24 Bildern pro Sekunde unterscheidet, ist vor allem die Bewegung des Körpers und des Kopfes, in dem das Auge sitzt: Im Kino ist der Körper still gestellt, durch die Abdunkelung wird der Blick fixiert auf die Leinwand, man erblickt nur das, was der Regisseur zeigen will. Bei natürlicher Körperbewegung muss der menschliche visuelle Apparat alles erfassen, was aufgrund der Drehungen und Wendungen des Kopfes vor die Augenlinsen kommt. Im Film dagegen gibt es eine Vorauswahl der Objekte, auf die der Blick sich fixieren soll, und Bewegungen haben kalkulierte Geschwindigkeiten, Blickwechsel sind vom Drehbuch ausgesucht und unterliegen nicht den spontanen Bewegungen des Körpers.
Bilder im Kopf, Bilder auf dem Bildschirm - was sind Bilder?
Woher nehmen sie ihre faszinierende, magische Wirkung?
Giordano Bruno, der von der katholischen Kirche als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannte große Gelehrte des 16. Jahrhunderts, hat über die für ihn unerklärliche Wirk-Macht der Bilder nachgedacht. Die „Vorstellungskraft oder Imagination“ sei für die Wirkung entscheidend, notierte er in seinen Manuskripten: „Es ist, als ob sich ein Fenster öffnet, das vorher verschlossen war, um die Sonne herein zu lassen.“ Die Phantasie gründe sich „nicht auf Wirkliches als vielmehr den Anschein von Wirklichkeit“: Entscheidend ist, „dass geglaubt wird, es sei wirklich.“ Das erläutert der Ketzer Bruno am Beispiel der Hölle: Die Vorstellungskraft mache die Hölle „auf eine ihr eigene phantastische Art wirklich“ und fessele die Menschen geradezu.
Das, was wir fühlen, riechen, schmecken, was wir an natürlichen, ungeformten Lauten hören können, erreicht unseren Leib direkt. Wir spüren es, reagieren spontan, bevor unser Gehirn die Sinnesreize verarbeitet und mit Erfahrungsmustern abgleicht und interpretiert. Und wenn wir sagen wollen, was wir wahr-genommen haben, muss das Gehirn die aufgenommenen Reize nach den Möglichkeiten der Sprach-Kultur analysieren. Manchmal sind wir auch sprachlos.
Was wir sehen, erreicht unseren Leib auch manchmal direkt, etwa wenn ein Gegenstand auf uns zufliegt und wir reflexhaft spontan ausweichen, bevor wir bewusst analysiert haben, was das eigentlich ist. Aber in der Regel reagieren wir auf visuelle Wahrnehmungen erst, wenn unser Gehirn sie zugeordnet hat. Zu „sehen“, was ist, bedeutet: Unser Gehirn ordnet die visuellen Reize ein und versieht sie mit Bedeutung.
Wort-Laute und Schriftzeichen sind besondere „Bilder“ – Strichmuster, symbolische Zeichen, die etwas anderes meinen, als sie sind. Um den Schriftbildern und Wort-Lauten eine Bedeutung entnehmen zu können, muss das Gehirn die Symbole zurückbeziehen auf das, was sie symbolisieren. Sie sind Mittel (Medien) einer indirekten Wahrnehmung.
Bilder simulieren eine selbstverständliche, direkte Wahrnehmung, und diese Illusion, zu sehen, „was ist“, überträgt sich auf die technischen Hilfsmittel des Sehens, auf das Mikroskop, das Teleskop, die Fotografie und den Film. Die Faszination, die der Film am Anfang bedeutet hat, legte sich nach wenigen Jahren. Wie selbstverständlich wir das nehmen. was wir sehen, ist das Ergebnis eines kulturellen Lernprozesses. Die Fähigkeiten der Wahrnehmung haben sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet. Es gibt eine Geschichte des Sehens.
Das Geheimnis des Seh-Sinns liegt darin, wie die visuellen Reize des Bildträgers mit Sinn ausgestattet werden. Schon für die Baum-Affen war es überlebenswichtig, das sich zweidimensional auf der Netzhaut abbildende Geflacker als einen in Wahrheit dreidimensionalen Handlungs-Raum zu behandeln. Das, was wir für wahr nehmen, ist aufs engste mit unserem Handeln verknüpft. Dass eine langer gerader Ast als Speer zu benutzen ist und dass eine fliegende schwarze Linie mit Spitze ein gefährlicher Speer sein könnte, war für die menschliche Wahr-nehmung überlebenswichtig.
Schnitz-Bilder und Statuen wurden als materielle Träger übersinnlicher Kräfte wahr-genommen und angebetet, das ist der Hintergrund des Streits um das religiöse Bildnisverbot, das eigentlich ein „Götzen-Verbot“ war. Auch für die Christen war das Bild eines Teufels noch im Mittelalter eine Erscheinung des wahrhaftigen Teufels.
Menschen des 18. Jahrhunderts hätten in dem Bild einer modernen Straßen-Kreuzung niemals eine Kreuzung wahrgenommen, weil es in ihrem Kopf so etwas nicht gab. Im Übergang zu Kunstbildern und zu einer fotografischen, filmischen und schließlich computergenerierten Bild-Realität entstehen neue Techniken für „virtuelle“ Realitäten, die sich vom direkten Blick auf die Umwelt insbesondere dadurch unterscheiden, dass die eigenen Körperaktivität von der visuellen Wahrnehmung entkoppelt ist.
Das Auge ist keine Kamera, sondern Teil eines Ensembles von Körpersinnen
Das moderne Verständnis vom „Sehen“ folgt seit dem 19. Jahrhundert dem Modell der Kamera – das Auge wird als passiver „Empfänger“ visueller Reize verstanden, die Netzhautbilder werden als passive „Bilder“ verstanden. Dieses Verständnis ist aus verschiedenen Gründen missverständlich und unzureichend. Das Starren auf technisch erzeugte Abbilder erfordert möglichst fixierte isolierte Augenlinsen. Das natürliche Sehen passiert aber mit Augen in einem Kopf, der auf einem beweglichen Körper sitzt und von einem wackeligen Knochengerüst getragen wird. Nicht nur der Körper wackelt, die Augenmuskeln müssen sich mit einer Frequenz von 200-400 Millisekunden bewegen, um durch Abtasten ein scharfes Bild erzeugen zu können (Sakkaden). Wenn wir eine Videokamera so ruckartig bewegen würden wie das Auge sich im Kopf auf einem Körper bewegt, dann würden wir auf dem Film nichts erkennen. Erst die Verarbeitung der Sinnesreize im Gehirn konstruiert aus den verwackelten Eindrücken eine verlässliche Wahrnehmung der Umwelt. Die Augenmuskeln müssen geradezu flackern (Sakkaden), nur dann kann das Gehirn das fixierte Bild wahrnehmen.
Vor den zappelnden Augen entstehen so Ausschnitte der Umwelt. Ein fixierter Blick eines bis in die Augenmuskeln fest gestellten und gelähmten Körpers, wie er der Momentaufnahme entspricht, wäre ein vollkommen unnatürlicher Sonderfall für lebendige Wesen. In seinem Höhlengleichnis hat Platon diesen Sonderfall sozusagen als philosophisches Experiment ausgesponnen - die Körper sind gefesselt, nicht einmal den Kopf können Platons Experiment-Menschen drehen. Das Licht strömt in passive Körper hinein. Jedes Lebewesen in dieser bedauernswerten Lage würde rasch gefressen. Über das lebendige Sehen sagen solche Experimente wenig – die Erkenntnisse aus solchen Gedankenexperimenten gelten nur im Rahmen der konstruierten Annahmen des Experiments.
Sinnliche Wahrnehmung ist in der Evolutionsgeschichte ein ganzheitlich leibliches Wahrnehmen, das Tasten, Riechen, Hören und Schauen vereint. Der visuelle Gesichtssinn ist nicht einfach ein isolierter Sinneskanal, sondern Teil eines komplexen körperlichen Wahrnehmungssystems. Der Gesichtssinn kontrolliert wie der Gleichgesichtssinn oder der Tastsinn zunächst die Bewegungen des Körpers und seine Einbindung in die Umwelt. Auch das Gleichgewichtsgefühl, das weiß jeder Fahrradfahrer, wird nicht nur vom vestibulären System im Ohr kontrolliert, sondern auch mit dem Blick. Der Verlust der visuellen räumlichen Orientierung kann Schwindelgefühle auslösen.
Das visuelle System erfasst die Bewegungen des Körpers und sucht aus dem umgebenden Licht Information über die der Umwelt zu gewinnen. Wenn ein Lebewesen über eine gut geputzte Glasplatte gehen soll oder über ein Gitter, durch das kein fester Boden sichtbar ist, erzeugt der Blick Symptome von Angst und verunsichert den Gang. Mit dem Gesichtssinn kontrolliert der Mensch die Sicherheit des Bodens, auf dem er steht. Mit dem Gesichtssinn steuert er den Körper in einer Menschenmenge, ohne Gesichtssinn wären komplizierte handwerkliche Bewegungen nicht möglich. Die jeweiligen Muskelbewegungen werden vor allem durch das Sehen geleitet.
Dabei ist der Gesichtssinn höchst aktiv. Er wechselt permanent zwischen einem panoramaartigen Herum-Schauen und einem präzisen Hin-Sehen (fokussieren). Der Gesichtssinn entnimmt dem Reizfluss, der auf die Netzhaut fällt, nur die Informationen, die für die Steuerung des Körpers und seine Orientierung in der Umwelt wichtig sind. Der natürliche visuelle Raum ist kein leerer, geometrischer Raum, sondern eine Menge von sichtbaren Elementen, von denen das visuelle System nur diejenigen wahr-nimmt, die für den Körper Bedeutung zu haben scheinen. Es gibt „Unaufmerksamkeits-Blindheit“, das bestätigt sehr schön das Gorilla-Experiment (Invisible Gorilla). Sehen von Dingen lässt sich meist nicht trennen von der Bewertung dessen, was man mit diesen Dingen machen könnte oder was die Dinge mit dem Leib machen könnten. Die visuelle Wahrnehmung dient der Selbstwahrnehmung innerhalb einer Umwelt, das Verhalten des Körpers steht unter der Kontrolle der (visuellen, akustischen, taktilen und olfaktorischen) Wahrnehmung.
Das Bedürfnis nach einer sicheren Umgebung erfüllt für kleine Kinder in der Regel die Mutter. Berührungen und Gerüche sind sofort nach der Geburt die wichtigsten Kommunikations-Medien. In dem Maße, wie das Kind sehen und Gesichter zu erkennen lernt, beginnt der Augensinn die direkte Körperberührung zu ersetzen: Immer wieder schaut das Kind, das von der Mutter losgelassen wird, nach dem Gesicht der Mutter, um sich an ihrem Bild zu beruhigen, und nur für einen kurzen Moment kann die Stimme der Mutter den visuellen Kontakt ersetzen. Hör-Sinn und Gesichts-Sinn sind Fern-Sinne. Erst wenn sich der heranwachsende Mensch von seiner Mutter zu lösen versucht, werden Hör- und Gesichtssinn dominant, mütterliche Gerüche und Berührungen werden kulturell diskriminiert und können als unangenehm empfunden werden.
Kultivierung des abstrakten Hin-Sehens
Kultivierung des „Sehens“ ist das zunehmende Abstrahieren vom leiblichen Wahr-nehmen zugunsten eines visuellen „Scannens“ der Umwelt. Die Kulturgeschichte des Sehens ist die einer zunehmenden Herauslösung eines rein visuellen Augensinns aus dem natürlichen ganzheitlichen leiblichen Wahrnehmen.
Das analytische Sehen ermöglicht die Komplexitätserhöhung der kognitiven Wahrnehmung. Erst das Gehirn macht aus den verschwommenen Grau-Werten des optisch Sichtbaren einen klaren, durch Sprache konkret benennbaren Gegenstand – aus einem fliegenden Wurfgeschoss eine gedachte Flugparabel-Linie. Erst Kulturen, die gelernt haben, was eine Parabel ist, ermöglichen mit ihrem Wissen, dass der Einzelne auch in der konkreten Flugbewegung eine Parabel „sieht“. Aus einer Menge völlig unterschiedlich geformter, zu unterschiedlichen Zwecken benutzter Behältnisse werden dann „Gefäße” oder „Töpfe”, und der konkrete Feuertopf wird zu einem besonderen Exemplar eines nur bildsprachlich existierenden und fixierbaren Gattungsbegriffes „Topf”. In ihrer kognitiven Evolution werden Menschen daher Augentiere – kein anderer Sinn, auch nicht der Hör-Sinn, hat in der Evolutionsgeschichte diese Differenzierung erfahren, die das körperlose, abstrakte Sehen ermöglicht. Das abstrakte Sehen schafft eine mentale Distanz zu dem praktischen Sinn des optischen abgebildeten Gegenstandes und den Emotionen, die damit verbunden sein können. Es schafft Spielraum für die willkürliche Belegung von Bild-Trägern mit Sinngehalten. Das abstrakte Sehen steht am Anfang der mentalen Konstruktionen der Kultur. (mehr dazu unter „Sehen und Denken”, M-G-Link)
Erweiterung der visuell wahrnehmbaren Realität
Wenn im Sommer 2016 Gruppen mit starrem Blick auf ihre Smartphones durch Städte und Parks streiften auf der Jagd nach Pokémons, dann waren sie getrieben von der Faszination an einer virtuellen Realität und gleichzeitig von einem archaischen Jagd-Instinkt – als Mammutjäger vor ihrem kleinen Bildschirm. Das neue Spiel kombiniert auf eine weltweit erfolgreiche Weise alte Instinkte mit neuen Techniken der virtuell erweiterten Realität.
Für wenige gab es die faszinierende „augmented reality“ auch früher. Ärzte, die die Bilder des Röntgen- oder Ultraschall-Gerätes vom Körper lesen können, sehen auch Dinge, die man mit unbewaffnetem Auge sonst nicht sehen kann, schließen aus besonderen Mustern auf der Folie ihrer medizinischen Kenntnisse auf außergewöhnliche körperliche Zustände.
Für solche Erweiterungen der Realität braucht man auch nicht unbedingt Instrumente, wie das Beispiel der Hölle schon für Giordano Bruno zeigte. Jede religiös motivierte Kindergärtnerin, die in einem schwerbehinderten Kind ein Geschöpf Gottes sieht und es entsprechend behandelt, hat eine „erweiterte Realität“ vor Augen.
Zum dem Themenkomplex Bildkultur
gibt es in meinem Blog www.medien-gesellschaft.de u.a. folgende Texte:
Was wir sehen - Bilderflut, Bild-Konsum, Bild-Handeln MG-Link
Wunder des Sehens - Grundlegendes zur Biologie des Gesichtssinns M-G-Link
Weltbild der blinden Fledermäuse M-G-Link
Wir Augentiere: Sehen und Denken - zu den visuellen Grundlagen der diskursiven Vernunft M-G-Link
Bigger than life - Mammutjäger vor der Glotze M-G-Link
Mediale Fiktion - Bausteine der menschlichen Kultur M-G-Link
Das Gehirn spinnt Sinn - Gehirngespinste M-G-Link
Aufmerksamkeit - über Neurologie und Soziologie einer knappen Ressource M-G-Link
Kraft der Bilder - Unser Gehirn liebt die virtuelle Realität: Herrschafts-Bilder, Bilder für Unsagbares M-G-Link
Bilder im Kopf - Über die neurologisch vermittelte Realitätswahrnehmung M-G-Link
Bilddenken, Bildhandeln - Wort-Laute, Gebilde und Gebärden M-G-Link
Bild gegen Schrift - Wortfetischismus und die Klagen der Schriftkultur über die Macht der Bilder M-G-Link
Geschichte der Bild-Kultur:
Geschichte des Sehens und Kulturgeschichte des Bildes M-G-Link
Kultgeschichte des Geschnitzten, Geritzten und Gemalten M-G-Link
Kult-Bild-Verehrung in der Antike MG-Link
Gottesbilder MG-Link
Gott im Kopf M-G-Link
Totenreich-Phantasien von Himmel und Hölle M-G-Link
Bild-Magie - Geschichte des christlichen Bild-Handelns M-G-Link
Die fremde Welt wird illustriert - Welt der Illustrierten M-G-Link
„Illustrirte Zeitung“ M-G-Link
„Illustrirte Zeitung“ - ein Blick in den Arbeitsalltag 1862 M-G-Link
Das Panorama - Sehnsucht nach virtuellen Welten M-G-Link
Ernst Litfaß und der Wandel der Berliner Straßen-Öffentlichkeit M-G-Link
Bewegende Bilder – Geschichte des Films im 19. Jahrhundert M-G-Link
Sensation der Fotografie M-G-Link
Kriegs-Bilder – Bilder-Kriege M-G-Link
Reizflut, Reizschutz, Inhibition, Neurasthenie M-G-Link
Visuelle Kultur des Islam M-G-Link
Gesichter zeigen und verschleiern M-G-Link
Sehen der Moderne - Neue Bilder in der neuen Medienkultur M-G-Link
Jens Reich: Der Zerfall der DDR 1989 und die Macht der Bilder Link
|

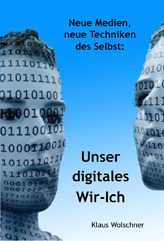
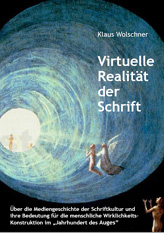
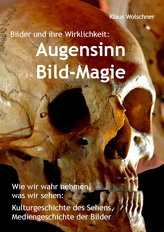
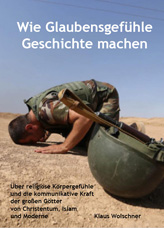

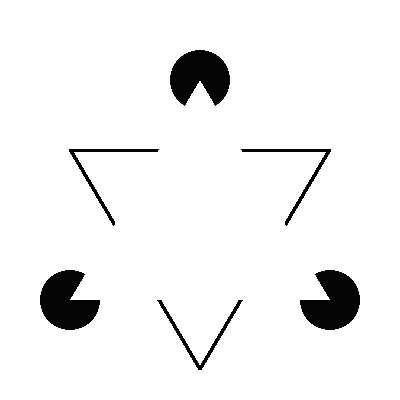 Sehen ist Praxis, Handeln: Das eigentliche Bild ist eine Projektion von Bedeutung auf die Lichtpunkte der Leinwand oder der physischen Natur.
Sehen ist Praxis, Handeln: Das eigentliche Bild ist eine Projektion von Bedeutung auf die Lichtpunkte der Leinwand oder der physischen Natur.