|
Bilddenken, Bildhandeln Bilder sind Träger von Denkprozessen. Bilder sind die Medien des Unsagbaren. 2024 Als Mittel der Kommunikation haben Bilder Wirkung auf den, der ein Bild sieht. Schon wenn sich Menschen mit Kleidung schön machen oder schminken, bedeutet das „Bild-Handeln”: Sie wollen das Bild, das andere sich von ihnen machen, bewusst und gezielt gestalten. Der Begriff „Bild-Handeln“ betont die Motive und Strategien derer, die Bilder aussenden oder auf Bilder aufmerksam machen. Die Inszenierung eines Herrschers ist genauso Bild-Handeln wie die Repräsentation einer transzendenten Macht. Die frühen ägyptischen Hieroglyphen waren Gottes-Zeichen, wurden als Repräsentanten göttlicher Macht verstanden und sollten wie die Bildnisse der Herrscher Macht demonstrieren im Sinne von „Bild-Handeln“. Die weit verbreiteten, offenbar populären Venus-Figurinen der Jungsteinzeit sind ein frühes Beispiel dafür, dass Menschen sich ihre eigenen Artefakte „schnitzten”. Schon die frühneuzeitlichen Flugschriften nutzten intensiv die Bild-Agitation, um die Wirkung ihrer Botschaft zu vergrößern - die „Sänger“ der Neuigkeiten konnten die Holzschnitte den leseunkundigen Zuhörern zum Beweis ihres Rede-Vortrages zeigen. Im 19. Jahrhundert nutzten dann die Zeitschriften und Zeitungen zunehmend die kommunikativen Möglichkeiten der Bilder. Ende des 19. Jahrhunderts kompensierte Kaiser Wilhelm den Verfall seiner Macht durch intensive Präsenz in der Öffentlichkeit – insbesondere mit wirkmächtigen Fotos in den populären Illustrierten. Bild-Handeln war so immer schon ein Instrument der Machtpolitik - aber das Bild-Handeln erreicht seine Adressaten nur, wenn es eine Geschichte erzählt, die ihre inneren Bilder bedient. Ein Bild kann Emotionen erregen, Sinn transportiert es erst durch die Worte, durch die es begleitet wird. Als „Bild” wird oft ein Bildträger bezeichnet, ein Stück Leinwand, ein fotografischer Abzug. Aber diese Bildträger sind nur Materie, von denen Lichtwellen reflektiert werden. Die stofflichen Bildträger sind für die Bild-Kultur nur die materielle Grundlage. So wie aus den Schallwellen, den ein Sprecher aussendet, Sprache erst wird, wenn einer da ist, der die Töne als Sprache begreift, so wird das visuelle Muster des Bildträgers erst zum Bild, wenn ihm Bedeutung zugemessen wird, also wenn ein Gehirn ihm Sinn zuschreibt. Denn das Auge nimmt kein Bild auf, sondern nur Lichtwellen. Ein „Bild“ entsteht durch die Projektion von Bedeutungen auf ein Objekt in der Welt „da draußen“. Der projizierte Gehalt erscheint dem Beobachter als die Bedeutung des Bildes, das ihm vor Augen steht. Das Gedächtnis gleicht die einkommenden Seh-Eindrücke ab mit den Mustern früherer Sinneseindrücke und ihren begleitenden Erzählungen. Diese Interpretationen können bewusst geformt werden durch inszenierte Bilder. Erst wenn der Seh-Eindruck das gewollte Bild-Denken auslöst, wird das Zeigen des Bildes, das Bild-Handeln, rezipiert und zu einem Akt gelungener Kommunikation. Wahrnehmung, kognitiv wie sinnlich, ist also letztlich ein „Bildhandeln“ im Kopf. Innere wie äußere Bilder sind Repräsentationen der Umwelt, in ihnen verdichten und fixieren sich Erinnerungen und Erfahrungen, Wahrnehmungen und Wunsche, Identitätsvorstellungen und Feindbilder. Das „Bild“, das eine Landschaft abgibt, wird in dem technischen Bildträger fixiert. Das Konzept der Landschaft ist ein Produkt des Reisens – erst durch die Faszination der fremden Landschaften wird der eigene Horizont zur „Landschaft“. Fixierungen der Landschaft gibt es in der Malerei vor allem seit dem 18. Jahrhundert. In Analogie zu den Bildern der fremden Landschaft wird dann die eigene Umwelt als „Landschaft“ Luthers und Luzifers einträchtige Vereinigung, Titel-Holzschnitt, 1535. Theater der Bild-Macht Das Theater der Macht ist ein Versuch, die Wahrnehmung der Welt „da draußen“ vorzustrukturieren. Zum Beispiel muss ein „Volk“ in Bildern und bewegenden Ritualen symbolisch sichtbar werden, sonst existiert es nicht für den Betrachter. Man kann ein Volk nicht sehen. Erst die bildhaften symbolischen „Repräsentationen“ in den Köpfen - etwa Fahnen - machen aus der Ansammlung von Menschen eine Einheit „Volk“. Das Volk ist eine durch Erzählungen und den Begriff verfestigte virtuelle Realität. Die Parole „Wir sind das Volk” untergräbt das Theater der Macht, indem sie ein Gegenbild zu den staatlichen Repräsentationen in den Köpfen produziert. Die sinnlich vor Augen geführten visuellen „Argumentationen” hinterlassen bei Menschen einen größeren Eindruck als rational ausgeklügelte Sätzen. „Wenn man dem gemeinen Volk hundert und aber hundert mal mit auserlesensten Worten und Gründen vorstellte, daß es seinem Regenten gehorchen sollte, weil es dem göttlichen Befehl und der gesunden Vernunft gemäß wäre, dieser König sich aber in Kleidung und sonst in allem so schlicht wie ein gemeiner Bürger aufführte, so würde man wenig ausrichten”, das stellte 1719 Johann Christian Lünig fest. Er plauderte damit das Geheimnis des Staats-Theaters aus, das der Sonnenkönig Die modernen Bild-Technologien haben das „Bild-Handeln“ für jedermann verfügbar gemacht. Während die vormodernen Bild-Symbole die Herrschaft und die Gemeinschaft der Beherrschten sichtbar machten, geht es in den modernen Bildern um die Individualität der Identität von jedermann. Die modernen Selfie-Bilder sind die Medien, in denen das Selbst sichtbar wird – auch für andere. Sie sind die Poesiealben des modernen Ich. Aus der Bildergalerie wird der eigene „Lebens-Film“ komponiert, „Ich“ als Krabbelkind, „Ich“ als Teenager, „Ich“ vor dem Eiffelturm. In der „Selfie“-Kultur wird das Bild, das ich von mir selbst poste, zu dem, was ich von mir selbst habe: Indem ich mich unaufhörlich als Selfie sehe, bestimmte Bilder von mir zeige und immer wieder anschaue, präge ich mein Selbstbild. Bilder können und sollen inszenieren, die meisten Selfies zeigen inszenierte Gesichtern, glücklich strahlende Menschen. Diese Norm der Selbstbilder wirken zwingend auf die Identität-Norm. Ich kann nicht anders als glücklich sein, wenn ich vorzeigbar sein will. Die eigene Biografie prägt sich als Folge von Bildern ein. Irritierenderweise ähneln sich diese individuellen Bild-Biografien. Die Bilder vervielfältigen die Massenkultur selbst dort, wo sie ihre Objekte scheinbar höchst individuell zeigen sollen. Die persönlichen Selfies sind Teil einer medialen Massenkultur. Bilder sind die Medien des Unsagbaren Laut-Verständigung ist die Basis der kulturellen Selbstentfaltung des homo sapiens, seine komplexe Sprache ist einzigartig im Vergleich zu den vielfältigen Kommunikationsformen anderer Lebewesen. Aber in der intimen zwischenmenschlichen Kommunikation können die Botschaften der Berührung und des Duftes entscheidend sein. Für die emotionale Gruppen-Kommunikation ist die Laut-Verständigung durch den subtilen Klang der Gesänge und durch Musik ganz wesentlich. Das gegenseitige Empfinden der Menschen ist geprägt von den unbewussten leiblichen Kommunikationsformen. Temple Grandin (geb. 1947) wurde sehr früh als Autistin diagnostiziert – und in ihrem jugendlichen Bildungsprozess nicht ausgesondert, sondern gefördert. Heute ist sie Hochschullehrerin und eine renommierte Tierforscherin. Ihre eigene Wahrnehmung als Autistin, so schreibt Grandin (u.a. in: „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“) ähnelt derjenigen von Tieren. Tiere haben eine oft erstaunliche Wahrnehmungsfähigkeit – müssen aber ohne Worte auskommen. Grandin vergleicht: „Als Mensch mit Autismus bestehen für mich die Gedanken aus fotorealistischen Bildern. [...] Wenn man mir ein Stichwort gibt, ‚Erdnuss' etwa, dann sehe ich eine Serie von Bildern, als erstes das Logo von Planter's Peanut, dann ein Restaurant, das Erdnussgerichte serviert, dann einen Sack voller Erdnüsse in einem Flugzeug." In ihrem Bewusstsein und ihrem Gedächtnis sind vor allem Bilder, die sie für die Außenwelt in Worte übersetzt. Bei Menschen mit Autismus-Störungen ist die Fähigkeit, Sprache gezielt einzusetzen, um etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu bekommen, oft beeinträchtigt. Für Grandin ist die Sprache kein originäres Instrument für das Denken. Auszüge aus ihrer Autobiografie: Autisten nehmen Details wahr und darauf bauen ihr Denken auf. Sie hat dieses Phänomen bei Tieren beobachtet: Spiegelungen von Licht auf einem nassen Boden oder eine sich bewegende Kette ängstigen Rinder, ein Gitter auf dem Boden hindert sie wie eine unüberwindliche Schranke am Weitergehen. Autisten haben zudem, so Grandin, eine starke Sensibilität für Töne. Autisten empfinden zudem eher eindeutige Gefühle, sie sind glücklich, ärgerlich, ängstlich oder traurig, sie scheinen aber nicht komplexe „gemischte Gefühle“ zu empfinden. Dominant ist Furcht als primäre Emotion. Menschen, die nicht über Sprache verfügen, kommunizieren mit Blicken, mit Gestensprachen, mit Händen und Füßen. Sie verbinden die Worte, die sie hören, mit einzelnen Bildern oder mit bewegten Szenen.
Die Sehnsucht nach anschaulichen Bildern von virtuellen Welten ist von den religiösen Kulten auf das Theater, auf den Roman und inzwischen auch auf den Film übergegangen. Die kulturellen Artefakte transportierten immer schon Freiräume für sentimentale Phantasien, sie stimulieren die Sinne durch (zumindest sprachlich) ausgemalte Emotionen und Farbigkeit. Die großen Bild-Illusionen der modernen medialen Kultur stehen in Konkurrenz zu einer banalen, manchmal elenden Wirklichkeit des Alltagslebens. Aber die „Realität“ des Alltags war immer grau im Vergleich zu menschlichen Phantasie-Produkten. Die Film-Phantasien sind der Technik voraus wie die Unsterblichkeits-Phantasien den praktischen Möglichkeiten der Medizinmänner. Phantasiereisen sind seit den Anfängen menschlicher Kultur ein Sonntags-Vergnügen für den menschlichen Geist, während der Leib in seinen biologischen Grenzen mit seinen unmittelbaren Bedürfnissen im Alltag regiert.
s.a. meine Blog-Texte Bildmagie – zur Geschichte des christlichen Bild-Handelns MG-Link Zum dem Themenkomplex Bildkultur gibt es in meinem Blog www.medien-gesellschaft.de u.a. folgende Texte: Bigger than life - Mammutjäger vor der Glotze MG-Link Literaturhinweise: Wolfgang Brückner, Bilddenken - Mensch und Magie oder Missverständnisse der Moderne (2013)
|

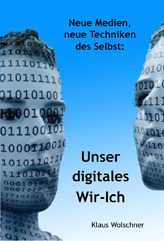
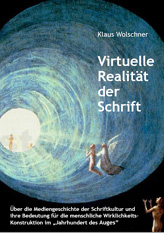
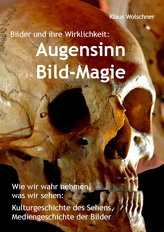
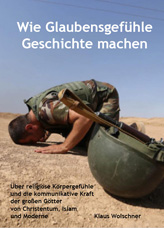


 wahrgenommen.
wahrgenommen.