|
Sprache Denken – Denken ohne Sprache
Wie wird Wahrgenommenes verarbeitet, wenn wir den Eindruck haben, wir „denken?
Wie können wir Sprache denken?
Über das Denken in Anschauungsformen, in Sprachsymbolen und in Mythen
2025-23
„Die physischen Einheiten, die als Gedankenelemente dienen,
sind mehr oder minder klare Bilder, die ‚willentlich’ reproduziert
und kombiniert werden können. Konventionelle Worte oder Zeichen
müssen erst mühsam in einem zweiten Stadium dafür gefunden werden.“
Albert Einstein
Die Frage nach der „Substanz“ des Denkens führt an die Grenzen der Selbstbeobachtung. Wie sollen wir mit dem Gehirn über das Gehirn nachdenken, wenn die Begriffe, in denen wir Gedanken formulieren und zu fixieren versuchen, schon Instrumente des Geistes sind, die das Beobachtete vorstrukturieren?
Denken ist vor allem „anschauliches Denken“, sagt der Philosoph und Medienwissenschaftler Rudolf Arnheim (1). Worte oder Begriffe sind nur abgeleitete Symbolformen, mit denen eine Sprachkultur gewohnheitsmäßig Wahrnehmungsbilder zu ordnen versucht. Philosophen wie Arnheim sind dabei Kinder der Schrift-Kultur - sie kennen Worte nur als Schrift-Worte und wenn sie an Sprache denken, haben sie ihre Schrift-Sprache vor Augen und nicht die Klang-Symbole der oralen Mundarten.
Wie die intelligente Tiere konnten die hominiden Vorfahren des homo sapiens, die noch keine Sprache für die Kommunikation verwendet haben, „in nicht-sprachlichen Formen der Repräsentation denken“ (Lohmar). Dieses „Denken ohne Sprache“ bildet eine Unterschicht des sprachlichen Denkens. Szenische Phantasmen (innere Bilder) und Gefühle sind die nicht-sprachlichen Repräsentanten im menschlichen Bewusstsein. Vieles, was uns in sprachlicher Form bewusst wird, gründet im nicht-sprachlichen Denken. Besonders deutlich ist das bei Gefühlen – Abneigung, Angst, Liebe -, bei denen die sprachliche Beschreibung versagt, obwohl sie sehr deutlich im Bewusstsein sind. Für das konkrete, leibnahe Denken scheint die Sprache eher das Medium zu sein, durch das vorhandene Empfindungen oder Schlussfolgerungen anderen mitgeteilt werden können, insofern auch ein Medium der Selbst-Beschreibung. Die nichtsprachliche symbolische Repräsentation ist eine wichtige Basis für die sprachlichen Symbole. Erst die abstrakten Begriffe entfernen sich von dieser Basis.
Ohne Worte denken?
Die Entwicklung des Sprachvermögens des homo sapiens hat frühestens vor etwa 40.000 Jahren begonnen. Lange vorher haben die frühen Hominiden ihren Lebensraum verlassen und die ganze Erde besiedelt, sie mussten – und wollten offenbar – sich an ganz unterschiedliche Lebensumwelten anpassen und neue Risiken bewältigen. Allein die Klimaschwankungen erfordern vorausschauendes Denken auf Grundlage zurückliegender Erfahrungen, umfangreiche Kooperation und soziale Institutionen sowie kommunikative Weitergabe von Expertenwissen bei der Planung der Ernährung voraus. Neues Wissen zur Beurteilung der gefundenen Nahrung in der neuen Umgebung (Pilze, Beeren usw.), zur Bestimmung der Lage von Fundstellen, der medizinischen Nutzpflanzen, der Beurteilung und Behandlung von Krankheiten musste gesammelt und weitergegeben werden. Für afrikanische Urwald- und Savannen-Bewohner gab es keine Notwendigkeit, über den Schutz vor der Kälte oder die Bildung spezieller haltbarer Vorräte nachzudenken. Solche Herausforderungen stellen hohe Ansprüche an die Verlässlichkeit der Gruppe.
Das „Medium“ des Denkens sind symbolische Repräsentanten. Mit den Symbolen kann ich bei Abwesenheit des Sachverhaltes spielen. „Denken“ setzt die Fähigkeit voraus, sich einen Erkenntnisgegenstand vorstellen zu können, auch wenn er aktuell nicht sinnlich wahrnehmbar ist (Objektpermanenz), und aus einer solchen Repräsentation von vorhandenen Erkenntnissen neue Erkenntnisse gewinnen zu können, die einen handelnden Umgang ermöglichen. Dieses Denken bezieht sich auf Objekte – als Fähigkeit, einen Gegenstand gedanklich so zu manipulieren, dass mögliche Hindernisse entfallen oder mögliche Probleme gelöst werden können. Zum Beispiel komme ich auf den Gedanken, einen Balken so zu drehen, dass er durch einen Spalt passt. Das Denken bezieht sich auch auf die soziale Gemeinschaft – auf die Bewertung der Absichten von Anderen, die entsprechende Hilfeleistungen erfordern oder für die gemeinsame Jagd entscheidend sind. Die soziale Gruppe ist dabei hierarchisch organisiert und das erfordert andere Verhaltens-Konsequenzen, je nachdem ob der Andere in der Hierarchie höher oder tiefer steht.
Affen, die in Gemeinschaften leben, haben nicht nur ein ausgezeichnetes Verständnis für die wechselnden Hierarchien, sondern auch ein szenisches Selbst-Bewusstsein für das, was ihnen passiert ist – von wem sie zum Beispiel verprügelt wurde oder wer einen guten Verwandten verprügelt hat. In ihr Gefühl gegenüber dem Missetäter – Angst oder Wut – geht ihre „Lebenserfahrung“ ein, die haben eine sinnlich vermittelte und an ihren Leib gebundene Form von Selbst-Bewusstsein. Sie können dem Täter ausweichen oder sich rächen. Sie können auch ihre äußere Erscheinung bewusst manipulieren – etwa humpeln, um einen Angriff zu vermeiden.
Weder Affen noch Menschenaffen haben ein Bewusstsein davon, was sie wissen und was ihr Gegenüber nicht weiß. Sie stoßen Warnrufe aus ohne zu wissen, ob ein anderes Tier in der Nähe ist, das die Gefahr nicht erkannt hat. Intelligente Verhaltensweisen von Affen sind auf eine bestimmte Situation bezogen, sie sind meist nicht in der Lage, ihre Verhaltensstrategien auf andere Situationen zu übertragen. Affen lernen nur durch Zusehen und Nachahmung.
Das Selbst-Bewusstsein des eigenen Wissens setzt offenbar schon Sprache voraus.
Die Laut-Sprache stellt ein öffentlich kommunizierbares Repräsentations-System zur Verfügung, das den Austausch von Gedanken ermöglichen soll und daher differenziertere Denk-Formen voraussetzt. Die Sprache ist daher die Grundlage der kulturellen Evolution des Menschen (Michael Tomasello, ratchet-effect). Sprache wird zur Grundlage der kulturellen Evolution, die Kinder im Schnelldurchgang nachholen müssen.
Worte bündeln Assoziationen, Analogien und Bedeutungs-Kreise
Fasziniert stehen wir vor der 30.000 Jahre alten Elfenbein-Statuette des Löwenmenschen von Hohlenstein-Stadel oder dem „Zauberer“ aus der Höhle Trois-Freres. Mit welchen Wort-Lauten mögen unsere Vorfahren ihre Geister benannt haben? Offenbar gab es in einem bestimmten Entwicklungsstadium des homo-sapiens-Gehirns das Bedürfnis, phantastische Hirngespinste nicht nur als Artefakte be-greifbar, fassbar und sichtbar zu machen, sondern auch zu benennen. Mit ihren Kunst-Objekten haben die Menschen ursprünglich Kräfte verkörpert, für die ihnen die Worte fehlten. Die mentalen Chimären waren als Gestalt konkret in der Welt, und wenn diese Artefakte angebetet wurden, deutet das darauf hin, dass die Menschen ihre Imaginationen als Teile einer realen Umwelt begriffen haben. Die mythischen Geschichten sind Versuche, die unbegreifliche Welt be-greifbar zu machen.
Tiere verhalten sich in den archaischen Götter-Geschichten wie Menschen, Menschen wie Tiere und Engel können fliegen wie die Vögel. In solchen Geschichten zeigte sich lange vor der Erfindung der Schriftzeichen eine hohe Flexibilität des Denkens, mit Metaphern, Analogien und Repräsentationen umzugehen. Solches Denken vollzieht sich in Assoziationen, nimmt Ähnlichkeiten wahr, Parallelitäten, Kausalitäten und Bedeutungs-Kreise und überträgt diese auf fremde Bereiche. Die kreativen Verknüpfungen werden über symbolische Wort-Laute zu erinnerbaren Strukturen, und wenn die Geschichten immer wieder erzählt werden, verfestigt sich ihr Bild im Wirklichkeits-Bewusstsein wie das des Weihnachtsmannes.
Die Klangformen der Worte sind Erzeugnisse des Geistes und nicht Abbilder der physischen Wahrnehmungs-Umwelt. Ursprüngliche Sprachlaute vermitteln eine bestimmte Perspektive: Der Name eines Tieres kann Gefahr signalisieren. Wenn er die Erwartung einer reichlichen Fleisch-Mahlzeit signalisiert, dann mobilisiert er den Jagd-Instinkt. Sprachliche Bezeichnungen sind nicht Abbilder der Wirklichkeit in ihrer möglichen Vielfältigkeit, sondern ein funktionales, gezieltes, handlungsorientiertes diskursives Be-Greifen der Umwelt. Arnold Gehlen nannte die Sprache ein „zweites Werkzeug“ zum Begreifen der Objekte.
Die Substanz der in Wortklänge gefassten Vorstellungsbilder müssen wir uns also eher so vorstellen, wie Impressionisten die ihre Wirklichkeit tupfend andeuten.
Der Psychologe Edward B. Titchener hat das in seinen Vorlesungen über die experimentelle Psychologie der Denkprozesse (1909) so formuliert: „Mein Bewusstsein ist in seinem gewöhnlichen Verhalten eine ziemlich vollständige Bildergalerie - nicht von fertigen Bildern, sondern von impressionistischen Notizen. Wenn ich höre oder lese, dass jemand sich bescheiden, würdig, stolz, unterwürfig oder zuvorkommend aufgeführt hat, so sehe ich eine visuelle Andeutung von Bescheidenheit oder Würde, Stolz oder Unterwürfigkeit oder Zuvorkommenheit. Die stattliche Heldin der Erzählung gibt mir ein Aufleuchten von einer hochgewachsenen Figur, von der ich nur eine Hand deutlich sehe, die einen stahlgrauen Rock rafft; von dem unterwürfigen Bewerber habe ich ein Aufleuchten einer gebückten Figur, von der nichts deutlich ist als der gekrümmte Rücken, und manchmal auch Hände, vor das nichtvorhandene Gesicht gehalten, mit einer Gebärde der Selbstverleugnung...“
Johann Wolfgang von Goethe hat die Poesie als die Form beschrieben, die dieser Unschärfe der Gedankenbilder am ehesten entspricht: „Die Poesie hat in Absicht auf Gleichnisreden und uneigentlichen Ausdruck sehr große Vorteile vor allen übrigen Sprachweisen, denn sie kann sich eines jeden Bildes, eines jeden Verhältnisses nach ihrer Art und Bequemlichkeit bedienen. Sie vergleicht Geistiges mit Körperlichem und umgekehrt, den Gedanken mit dem Blitz, den Blitz mit dem Gedanken, und dadurch wird das Wechselleben der Weltgegenstände am besten ausgedrückt.“
Klang-Wahrnehmung
Akustische Reize sind Elemente der physischen Realität, die sich der sprachlichen Interpretation und sprachlich sortierender Wahrnehmung weitgehend entziehen - wir nehmen sie zunächst nur als Geräusche wahr.
Die Kommunikations-Kulturen der Tiere haben aus dem Chaos der Geräusche eine Welt von Klang-Geräuschen zu einer Kunstwelt selektiert - Töne. Menschliche Kulturen haben aus diesen Tönen zunächst mit fünf gleichgroßen Schritten eine (pentatonische) Tonleiter konstruiert. Damit war das gespürte Kontinuum der Töne in eine eindimensionale Schritt-Ordnung gebracht. Die Kulturmusik spielt mit der Unterschiedlichkeit der Tonlängen und der Verschiedenheit der Rhythmen und mit den Intensitäten verschiedener Töne und mit Instrumentalklängen. Auch die diatonische Tonleiter der abendländischen Musik ist natürlich ein Kulturprodukt, mit dem der „musikalisch gebildete“ menschliche Verstand die „reinen“ Töne in gut und böse sortiert.
Musik ist ein Ausdrucksmittel von Stimmungen, sie ist als Orientierungsmittel für Handeln im Alltag wesentlich. Allein mit diesem Medium sind aber Beschreibungen der physischen Realität nicht möglich. Differenzierte Sprachgeräusche bilden eine weitere Stufe der Sortierung, in der Vokale und Konsonanten in festgelegten Reihungen wechseln. Gleichwohl werden Sprachgeräusche erst durch ihren Bezug auf andere Wahrnehmungsarten – taktile und visuelle - sinnvoll. Nicht nur in der Welt der Tiere, auch in der der sprechenden Menschen bleiben die sprachlich schwer fassbaren „Geräusche“ ein wichtiges Instrument der Orientierung und der Kommunikation. Nicht zufällig wurde wichtige Sprach-Kommunikation in alten Kulturen „gesungen“, die Kommunikation des Heiligen bedient sich bis heute dieser Ton-Elemente der Sprache. Je mehr sich die menschliche Kultur auf den schriftsprachlichen Zugang zur physischen Welt spezialisierte, desto weniger bewusst wurde die Gestik und Musik hinter der Sprache.
Das Hören ermöglicht eine instinktive, schnelle Orientierung. Das Sehen bietet den Menschen sehr viel mehr Einblick in die Dinge und die Ereignisse der Außenwelt. „Der Gesichtssinn ist daher der Hauptbereich des Denkens.“ (Arnheim) Wenn ein Mensch von äußeren visuellen Wahrnehmungsreizen abgetrennt wird, beginnt das Gehirn diese bald durch Erinnerungsbilder und Phantasievorstellungen zu ersetzen. Die Verarbeitung von Sinneserlebnissen, also die Sinnestätigkeit des Gehirns, ist eine Vorbedingung für das Funktionieren des Geistes. (vgl. „Sehen und Denken“, M-G-Link)
Sprache als ein Instrument der Wahrnehmung
Um einen Gegenstand zu erkennen, muss ich ihm Aufmerksamkeit schenken, mich ihm zuwenden, ihn „aufsuchen“. Etwas zu identifizieren bedeutet immer, einzelne Merkmale aus dem „Rauschen“ der sinnlichen Eindrücke zu selektieren. Wahrnehmung ist immer die aktive Wahrnehmung von Objekten in ihrer Bedeutung. Das Erkennen geht dabei von einer akustischen oder visuellen Reizung aus, das spezifisch menschliche Erkennen zielt auf das Benennen. Wort-Laute sind beständige Zeichen, daher besonders nützlich als Vermittlungsinstrument. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf die Phänomene, die starr sind und ihrem Kriterium der Beständigkeit entsprechen.
In der Neurophysiologie der Großhirnrinde fanden Hirnforscher - jedenfalls bisher - keine grundsätzlichen Unterschiede bei der Verarbeitung akustischer, visueller oder taktiler Sinnesreize. Die Wortsprache, entstanden als „Wortkraulen“ (2), ist rein akustisch nichts weiter als ein Fluss besonders strukturierter Geräusche. Das Reich des Hörbaren liefert einen unerschöpflichen Vorrat sinnleerer Tonformen. Schon der Hund „versteht“ da aber einiges, wenn Herrchen mit ihm „spricht“. Erst die strukturierte Wahrnehmung von Tönen, Klängen und Rhythmen macht aus dem Geräusch eine Abfolge von Konsonanten und Vokalen. Das Geräusch wird erst vom Wahrnehmungsapparat zu Sprache strukturiert. Die Klänge der Sprache erlangen ihren Sinn und ihre Schönheit dadurch, dass Worte identifiziert werden und kulturell vermittelte Bedeutung haben.
Worte werden damit zu Hilfs-Strukturen für Wahrnehmung, aber keine neutralen. „Was in der einen Sprache als eine einfache, unteilbare Idee erscheint, wird in einer anderen durch verschiedene phonetische Gruppen bezeichnet“, hat der Anthropologe Franz Boas festgestellt. Die Kategorisierungen der Sprache folgen praktischen sozialen Bedürfnissen der Menschen und beeinflussen das Denken.

Wer beim Blick auf dieses Bild „wau“ hört,
sieht den Hund sofort
„Wau“, „Hund“ – das Kind lernt zu sprechen, indem es visuelle Sinneseindrücke sortiert und mit emotionalen Bedeutungen belegt. Das Kind muss dabei die Gegenstände anfassen, in den Mund nehmen, um sie zu „erkennen“. Praktische Aktivitäten sind die Grundformen der Wahrnehmung, auf denen abstrakte Erkenntnistätigkeiten aufbauen. Das Gehirn sucht stabile Muster, die seine verwirrenden Wahrnehmungen sortieren helfen und wie Wahrnehmungs-Hypothesen getestet werden können. Bevor ein kleiner Mensch „weiß“, dass eine schöne rote Herdplatte schmerzhaft „weh tut“ und dass dies mit der Lautfolge „aaa” und “A-iiiß?” von der Mutter signalisiert wird, muss er das mehrfach ausprobieren. Mit der Sprache stellt das soziale Umfeld dem Kind Orientierungsmuster zur Verfügung, deren Sinn es sich aktiv erschließen muss. Menschen eignen sich die Welt so an, wie die Sprache ihrer Kultur es ihnen nahe legt.
Das Kind erfährt, dass Erwachsene bestimmte Situationen mit Sprachlauten begleiten. Die Sprachlaute verknüpfen verschiedene sensorisch erfahrbare Elemente der Situation, das stabile Lautmuster hilft, aus ähnlichen Situationen ein stabiles Element der Wahrnehmung zu abstrahieren. Das Lautmuster führt dazu, dass die Aufmerksamkeit auf das stabile Element gelenkt wird. Bei dem Ruf „Vorsicht Hund“ betrachtet niemand mehr den Zaun und die schönen Rosen, alle Aufmerksamkeit wird zentriert auf die Frage: Wo ist der Hund? Sieht er gefährlich aus? Mit sprachlichen Artikulationen kann ich die Aufmerksamkeit anderer lenken.
Wort-Laute stabilisieren Bedeutung
Eine Viertelsekunde braucht unser Gehirn, um für einen Stimulus erste sinngebende Informationen zu konstruieren und eine erste Wahr-Nehmung zu gestalten. Die Sehzentren sortieren die Reflexionsspektren der Lichtwellen zu Farbeindrücken, schätzen Entfernung und die Bewegungsrichtung und korrelieren damit die Größe. Aus der Erinnerung werden assoziative Gehalte zum Vergleich herangezogen. Das limbische System nimmt eine emotionale Bewertung vor, freundliche oder feindlich, angenehm oder unangenehm, gut oder böse. In dieser kurzen Zeit leistet das Gehirn vorbewusste Arbeit, um den Strom neuronaler Impulse zu sortieren und so zu modellieren, dass daraus eindeutige Signale werden, die uns als Sehen und Fühlen bewusst werden können und mit Laut-Worten stabilisiert werden.
Wort-Laute, die leibliche Assoziationen ermöglichen, werden besonders schnell verstanden. Auch unsere durch die Schrift neu formierte Sprache lässt noch sehr deutlich die Brücken ins leibliche Empfinden erkennen. Die kognitiven Modelle des Denkens reduzieren Abstraktes auf konkret Leiblich-Räumliches. Die Metaphern, mit denen wir unsere Alltagskommunikation beinahe gedankenlos bewältigen können, fassen selbst abstrakte Strukturen sprachlich als konkret greifbar. Wir „begreifen“ ein Argument oder den Sinn einer Geste und „sehen“ verschiedene Aspekt eines Arguments. Unser Zeitverständnis kennt ein „vor“-her und ein „hinter“-her, die Zeit kann „eilen“ oder „drängen“. Wir „haben“ Zeit oder „verlieren“ sie wie ein physisches Objekt. Die Farbe „rot“ als mentales Konzept steht für alles, was lebendig, gesund, reif oder in Blüte ist. „Körperliche Wärme“ ist unmittelbar verständlich als Metapher für Zuneigung. Gedanken oder Ereignisse sind „groß“. Für Ähnlichkeiten werden Metaphern der physischen Nähe verwendet. Schwierige Situationen können zur „Last“ werden.
Sprache ist ein Kommunikationsmedium, den sprachlichen Bezeichnungen müssen daher soziale Verständigungen darüber zugrunde liegen, was gemeint ist, sonst empfinden wir die Laute als „plappern“. Das Kind, das sprechen lernt, lernt die Gegenstände seiner Aufmerksamkeit so zu bezeichnen, wie sie „gewöhnlich“ in seiner sozialen Umgebung bezeichnet werden. Mit der Sprache vermittelt sich die Kultur der Gemeinschaft. Sprache lenkt also auch die Aufmerksamkeit auf das, was in einer Kultur Bedeutung hat. Während es für eine ländliche Kultur wichtig ist, die Vogelarten an ihren Gesängen unterscheiden und benennen zu können, geht diese Beobachtungsfähigkeit bei Städtern verloren. In der Sprache verbinden sich die eigenen Erfahrungen mit den Gegenständen der Aufmerksamkeit mit den Bewertungen anderer – die stabilen Elemente der sprachlich geordneten Wirklichkeit können also durchaus persönliche Einfärbungen haben. Emotional stark besetzte Unglücks-Erfahrungen führen in der Regel dazu, dass die Utensilien des Unglücks emotional anders belegt sind als im kulturell gewohnten Sprach-Empfinden.
Dem sprach-akustischen Handeln geht das sensomotorische Handeln voraus, Mimik, Gestik, Zögern, Verdecken, Verstellen, Täuschen, Lachen, Brummen, Quieken, Schreien, alles Kommunikationsformen, die im Tierreich in seiner Evolutionsgeschichte zu beobachten sind. Schon Ludwig Noiré hatte in seinen Überlegungen zum „Ursprung der Sprache“ 1877 die Vermutung geäußert, dass gemeinsame Tätigkeiten mit Gesang und rhythmischen Rufen begleitet wurden und die Lautsprache dabei die Funktion eines kommunikativen Bindemittels bekam. Durch lautes Schreien, Rufen und Gesang werden bedrohliche Ängste abgewehrt und geradezu beschworen, führte Ernst Cassirer diesen Gedanken fort, Sonnen- und Mondfinsternisse, Stürme und Gewitter werden durch Geschrei und Geräusch „gebannt".
Auch Tiere haben ein körperliches Selbst-Bewusstsein und sie reagieren auf visuelle Muster, die Feinde signalisieren oder Fressbares. Sie reagieren auf Duft- oder Laut-Kommunikation. Sprachlaute sind unendlich vielfältiger und komplexer, um einen Gegenstand zu bezeichnen, und sie benötigen immer weniger die unterstützende Zeigegeste und den sichtbaren Kontext, um einigermaßen eindeutig verstehbar zu sein. Sprache ist auch in ihrer vor-schriftlichen Form eine symbolische Form der Stabilisierung von kommunikativen Umwelt-Bezeichnungen. Das visuell wahrgenommene Objekt muss nicht mehr mit einer Zeigegeste und einem „da“ bezeichnet werden, wie es bei Kleinkindern oder in „sprachlos“ erschrockenen Situationen „normal“ erscheint, sondern wird als „Adler“ oder „Milch“ oder anderes eindeutig akustisch benannt. Emotionen können spontan überwältigend sein, also das Bewusstsein unterlaufen und äußern sich in „unwillkürlichen“ Bedeutungsträgern, etwa ein Schreck-Schrei.
Sprachliche Äußerungen sind Aufforderungen, eine spezielle Wirklichkeit zu erkennen. Der sprechende Mensch unterscheidet Muster der Zeit - „gestern", „morgen“- und Muster der Stofflichkeit, „weich” und „hart”. Die differenzierte Sprache stellt Instrumente bereit, um aktive und passive Erfahrungen zu sortieren. Wenn ich eine Holzkonstruktion „Stuhl" bezeichne, dann „sehe“ ich die Funktion der Holzkonstruktion als Sitz-Stück. Die Aufmerksamkeit wird anders fokussiert, wenn ich die Holzkonstruktion sehe und „Teakholz“ oder „Brennholz“ sage. „Das sprachliche Signal (als angeeignete, automatisierte Sprechbewegung) ist also eine Art Kristallisationskern, um den herum alle individuelle Erfahrung des Individuums mit dem ‚Gegenstand’ aufgebaut wird.“ (Jürgen Messing) Je mehr Sprechakte eingeübt werden, um so mehr verfestigen sich die damit verbundenen Wahrnehmungs-Filter im Unbewussten.
 Dinge, die benannt sind, scheinen bekannt zu sein, sind einsortierbar – und provozieren deutlich weniger Neugier als unbenennbare Phänomene. Phänomene, die nicht durch das Gitter der sprachlichen Fixierungen betrachtet werden können, erscheinen dem Bewusstsein fremd, einzigartig – oder werden schlicht übersehen. Die Besonderheit des menschlichen Bewusstseins ergibt sich aus den Möglichkeiten, die Laute zu Sprach-Symbolen zu formen und damit sehr viel mehr und komplexere Situationen in der Wahrnehmung zu stabilisieren und mit stabiler Bedeutung zu fixieren, die vorsprachlichen sinnlichen Wahrnehmungen bleiben aber die körpernäheren und emotional bedeutsameren. Dinge, die benannt sind, scheinen bekannt zu sein, sind einsortierbar – und provozieren deutlich weniger Neugier als unbenennbare Phänomene. Phänomene, die nicht durch das Gitter der sprachlichen Fixierungen betrachtet werden können, erscheinen dem Bewusstsein fremd, einzigartig – oder werden schlicht übersehen. Die Besonderheit des menschlichen Bewusstseins ergibt sich aus den Möglichkeiten, die Laute zu Sprach-Symbolen zu formen und damit sehr viel mehr und komplexere Situationen in der Wahrnehmung zu stabilisieren und mit stabiler Bedeutung zu fixieren, die vorsprachlichen sinnlichen Wahrnehmungen bleiben aber die körpernäheren und emotional bedeutsameren.
Während ein Anblick eine scheinbar direkte Verknüpfung zu der Bedeutung aufweist, die ich dem Gesehenen zuweise, sind bewusste Sprachlaute willkürliche Bedeutungsträger. Zwischen den Reiz und die Reaktion tritt die Wahrnehmung des Reizes, also die Summe der kulturell überlieferten Aneignungs-Muster. Arnold Gehlen sprach vom „Hiatus“: Eine kultivierte Reaktion auf einen Reiz ist nur möglich, wenn der Mensch Reize mit seinem kulturell erworbenen Potential an Mustern sortieren und differenziert „wahr“-nehmen kann.
Formen des Denkens, die abstrakte Begriffe verwenden, sind Menschen ohne Sprachvermögen nicht zugänglich. „Kraft“, „Energie“, „gerade Linien“ gibt es nur in der Sprache. Bildliche Vorstellungen handeln zudem immer von etwas, das vorstellbar ist, dass es gibt. Der Gedanke, dass es etwas nicht gibt, erfordert komplexe Sprache. Kulturen ohne komplexe (Schrift-)Sprache (siehe MG) können nur die Vorstellung aufrufen – „ich nehme den Stock“ – und ein „nein“ dahinter setzen.
Über „Sprache” nachdenken kann man also nur mit den sprachlichen Instrumenten der Schrift-Kultur.
Temple Grandin oder: Autistinnen denken in Bildern
Temple Grandin (geb. 1947) wurde sehr früh als Autistin diagnostiziert – und in ihrem jugendlichen Bildungsprozess nicht ausgesondert, sondern gefördert. Heute ist sie Hochschullehrerin und eine renommierte Tierforscherin. Ihre eigene Wahrnehmung als Autistin, so schreibt Grandin (u.a. in: „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“) ähnelt derjenigen von Tieren. Tiere haben eine oft erstaunliche Wahrnehmungsfähigkeit – müssen aber ohne Worte auskommen. Grandin vergleicht: „Als Mensch mit Autismus bestehen für mich die Gedanken aus fotorealistischen Bildern. [...] Wenn man mir ein Stichwort gibt, ‚Erdnuss' etwa, dann sehe ich eine Serie von Bildern, als erstes das Logo von Planter's Peanut, dann ein Restaurant, das Erdnussgerichte serviert, dann einen Sack voller Erdnüsse in einem Flugzeug." In ihrem Bewusstsein und ihrem Gedächtnis sind vor allem Bilder, die sie für die Außenwelt in Worte übersetzt.
Bei Menschen mit Autismus-Störungen ist die Fähigkeit, Sprache gezielt einzusetzen, um etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu bekommen, oft beeinträchtigt. Für Grandin ist die Sprache kein Instrument für das Denken. Auszüge aus ihrer Autobiografie:
„Meine Ohren sind wie Mikrofone, die jedes Geräusch aufnehmen und verstärken. Ich habe deshalb zwei Möglichkeiten: Ich öffne meine Ohren und werde überschwemmt von Geräuschen oder ich schalte mein Gehör ab. (…) Wenn Erwachsene direkt zu mir sprachen, konnte ich alles verstehen, was sie sagten. Wenn Erwachsene untereinander sprachen, dann klang dies wie Kauderwelsch. Ich hatte die Wörter, die ich sagen wollte, in meinem Kopf, aber ich konnte sie nicht aussprechen; es war wie ein großes Stottern. Wenn mich meine Mutter aufforderte, etwas zu tun, kreischte ich.”
Grandin hat viele Aufsätze und Vorträge zum Thema Autismus verfasst und lehrt Tierpsychologie an der Colorado State University. Sie zeigt viele Fähigkeiten, die wir ‚Normalen‘ ebenfalls besitzen, aber einige davon sind besonders stark ausgeprägt. Ihre Autobiographie beginnt mit den Worten:
„Ich denke in Bildern. Worte sind für mich wie eine zweite Sprache. Ich übersetze sowohl mündlich als auch geschriebene Wörter in Vollfarbfilme, komplett mit Ton, die wie ein Videorekorder in meinen Kopf. Wenn jemand mit mir spricht, werden seine Worte sofort in Bilder übersetzt. Sprachorientierte Denker finden dieses Phänomen oft schwer zu verstehen."
Aber Begriffe wie „Ding“ oder „Etwas“ sind kaum in Bildern zu fassen, Bilder stellen gewöhnlich bestimmte Gegenstände dar. Grandin nennt als Beispiel das Wort „Elemente“ oder Eigenschaften wie „schön“, „trocken“ oder „brauchbar“. Wie kann man Begriffe wie Frieden, Ehrlichkeit, Macht, Ehre, Wille visualisieren? Frieden stellt sich Grandin als Taube vor oder als eine indianische Friedenspfeife, oder als Filmaufnahme der Unterzeichnung eines Friedensvertrages. Ehrlichkeit wird durch das Bild einer Person, die ihre Hand im Gerichtssaal auf die Bibel legt, dargestellt. Macht und Ruhm Gottes werden durch einen Regenbogen und einen Hochspannungsmast dargestellt. Der Wille Gottes wird durch einen Gott dargestellt, der einen Blitz schleudert.
Gefühle, so Grandin, sind bei Autisten anders organisiert. Gefühle sind mehr an Orte als an Personen gebunden. Mitgefühl mit anderen Personen visualisiert Grandin als Bild von einer Person mit konkreten Sorgen.
Die Rinder-Expertin Temple Grandin glaubt, dass auch Tiere in Bildern denken - ebenso wie sie selbst. Manche Tiere verfügen über ein hervorragendes optisches Gedächtnis und können viele Einzelheiten einer Situation visuell memorieren. Grandin merkt sich den Platz ihres Wagens auf einem großen Parkplatz wie Eichhörnchen, die sich die Lageplätze der vielen hundert Nüsse einprägen, die sie für den Winter verstecken.
Autisten nehmen Details wahr und darauf bauen ihr Denken auf. Sie hat dieses Phänomen bei Tieren beobachtet: Spiegelungen von Licht auf einem nassen Boden oder eine sich bewegende Kette ängstigen Rinder, ein Gitter auf dem Boden hindert sie wie eine unüberwindliche Schranke am Weitergehen. Autisten haben zudem, so Grandin, eine starke Sensibilität für Töne. Autisten empfinden zudem eher eindeutige Gefühle, sie sind glücklich, ärgerlich, ängstlich oder traurig, sie scheinen aber nicht komplexe „gemischte Gefühle“ zu empfinden. Dominant ist Furcht als primäre Emotion. Menschen, die nicht über Sprache verfügen, kommunizieren mit Blicken, mit Gestensprachen, mit Händen und Füßen. Sie verbinden die Worte, die sie hören, mit einzelnen Bildern oder mit bewegten Szenen.
Um diese Form des assoziativen Bild-Denkens plausibel zu machen, verweist Dieter Lohmar auf die Tagträume, die einen erstaunlich großen Teil unseres Bewusstsein-Stromes ausmachen. Tagträume handeln von wunscherfüllender Lust, von Furcht und Wut, also von Basis-Emotionen. In den Szenen der Tagträume erproben wir mögliche Handlungsoptionen, wir „spielen sie durch“. Insofern handelt es sich um „Kino im Kopf“.
In diesen Episoden unserer Tagträume treten die sprachlichen Ausdrücke in den Hintergrund zu Gunsten von bildhaften Elementen. Es gibt verschiedene empirisch-psychologische Untersuchungen über die Sex-Tagträume von Männern. Es gibt aber auch Angst-Tagträume oder Erfolgs-Tagträume. Anders als die nächtlichen Träume respektieren die Tagträume die Gesetze von Identität und Kausalität und die Zeitordnung von Ereignissen.
Die Sprache und das Heilige
Orale Sprache, also Sprache, die nicht durch Schriftformen und deren Grammatik geformt ist, ist dabei ein Lautzusammenhang. Erst die Schrift „zerschlägt“, wie Cassirer formuliert, die fließende Sprache in Wörter mit Regeln. Die ursprüngliche orale Sprache muss man sich als akustische Begleitung von körperlichen Kommunikations-Handlungen vorstellen, sie ist auch mit ihren „aah“s und „oooh“s ein Element der staunenden Wahrnehmung der Umwelt. Erst mit der Schriftform der entwickelten Sprache können sich die Laute von den Gebärden ablösen, Laute können Dinge bezeichnen, die nicht sichtbar und also nicht mehr zeigbar sind, die nicht mehr nur anschauliche Merkmale begleiten. Solche Worte werden zu Bausteinen immer abstrakterer Gedanken, etwa wenn der Begründer der griechischen Philosophie, Thales von Milet um 600 v.u.Z. die Frage nach dem Ursprung der Welt stellte und als Antwort erklärte, alles sei aus dem Wasser hervorgegangen, das man sich voll von Göttern vorstellen müsse. Über die konkrete Erfahrung, dass es ohne Wasser kein Leben gibt, hatte sich diese Wort-Wirklichkeits-Konstruktion schon weit erhoben.
Sprache ist eine Technik des Geistes, mit der der Mensch seine Wahrnehmungs-Umwelt stabilisiert. Das gilt sowohl für die greifbaren, konkret handhabbaren Dinge wie für die un-greifbaren Zusammenhänge, für die Sprache scheinbar genauso fixierende symbolische Formen bereitstellen kann: die Seele als Widerschein und Ankerpunkt für das Unbegreifliche, das „Göttliche“ im Menschen. In der Sphäre des Heiligen wird das überall in der Wahrnehmungs-Umwelt drohende Ungewisse, Unbestimmte und Beängstigende sprachlich gefasst und geordnet. Damit „umzugehen“ wird zu Sache der Schamanen und Priester, die die Gruppe nur rituell einbeziehen. Im 19. Kapitel des 2. Buches Moses (Exodus) ist diese archaische Bedeutung der Sprache beschrieben: „Und alles Volk nahm Donner und Blitz wahr, den Schall des Horns und das Rauchen des Berges. Da sie es aber wahrnahmen, flohen sie, stellten sich in der Ferne auf und sprachen zu Moses: Rede du mit uns, wir wollen gehorchen, und lass Gott nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben.“ Gott redete im Rauch und im Donnerschall, „und da der Herr ausgeredet hatte mit Moses auf dem Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses; die waren beschrieben mit dem Finger Gottes.“ Da werden ganz profane Anweisungen für das Leben der Gemeinschaft als Gebote Gottes verkündet, etwa: „Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird.“ Die Ordnung des Gruppenlebens muss eingehalten werden, um die Götter nicht zu erzürnen, die rituelle Praxis ist die „Sprache“, die die Götter verstehen und sie gnädig stimmen soll – so begreift die archaische Sprach-Kultur das Unbegreifliche, so versucht der Mensch einen Zugriff auf das, was er praktisch nicht in den Griff bekommen kann.
Schrift-Sprache, Schrift-Bilder, visuelle Schriftzeichen
„Wörter“ waren in oralen Kulturen reine Lautverbindungen ohne Verankerung und Fixierung in visuellen Schriftzeichen. Für unser heutiges Verständnis ist Sprache selbstverständlich Schriftsprache. Es liegt auf der Hand, dass reine Mundarten andere Denk-Instrumente sein müssen als die Schrift-Sprachen, auf deren Grundlage in der europäischen Neuzeit die modernen Wissensordnungen entstanden.
Mit der Differenzierung einer Sprache als Schriftsprache kommen besondere Wortklassen hinzu, Adjektive, Konjunktionen. Schriftsprachen verfügen über komplizierte Konjunktionen – weil, nachdem, solange, sondern, beziehungsweise – wo oralen Sprachen kurze Sätze nur aneinander reihen und der Hörer sowieso ungefähr weiß, was gemeint sein könnte.
Mit der Verinnerlichung dieses Sprechens entsteht das komplexe Denken. Die Sprache wird zum Medium des Denkens, in manchen Situationen ist inneres Sprechen ein Hilfsmittel und ein Zeichen für das Denken. Wenn ich „im Kopf“ 31 x 31 rechnen will, bediene ich mich des inneren Sprechens, um Teilsummen zu fixieren.
Die Schriftsprache produziert klare Vorstellungen von konkret sortierbaren Einheiten – es gibt nicht mehr verschiedene Lautworte für die in der konkreten Umwelt vorkommenden Früchte, sondern „Äpfel“ im Unterschied zu Pflaumen. Es gibt schriftsprachlich konstruierte abstrakten Einheiten, die sinnlich vorstellbar nur noch sind über konkrete Erinnerungen oder Symbole: „Demokratie", „Erbschaft“, „Nation". Solche Worte prägen Realitäts-Vorstellungen und das Wirklichkeits-Bewusstsein, auch wenn an einer „Nation“ eigentlich nur ein Wort wirklich ist, symbolisiert das Abbild des Staatsoberhauptes, durch das Wappen oder die Fahne. Vor der Erfindung der „Nation“ gab es viele Dialekte, die unabhängig von den Machtgrenzen eines Fürstentums waren und in ihren Grenzräumen von den Nachbar-Dialekten beeinflusst waren.
Die Begriffs-Sprache hilft wie eine Schablone, die chaotische Fülle der Wahrnehmungs-Dinge als lineare, eindimensionale Kette von Worten zu sortieren, sie erlaubt es, analytische Fragen zu stellen. Die Sprache drängt der Wahrnehmung gerade fixierte Typisierungen auf, die dann mit einem Zeichen benannt werden können. Sie hilft, das Vorstellungsmaterial als eine überschaubare, begrenzte Menge von benennbaren und prägnanten Abbildern wahrnehmbar zu machen und in der Erinnerung zu fixieren.
Während die orale Sprache die Wahrnehmung nach praktischen Bedürfnissen sortiert und benennt, kann Schriftsprache die Wahrnehmungs-Objekte nach Kriterien gruppieren, die der praktischen Lebenserfahrung des Sprechenden widersprechen. Die Sprache kann Begriffe konstruieren, denen keine greifbaren Dinge entsprechen. Der Satz ‚Löwen sind Katzen’ ist ein solcher Satz. Die Worte haben keinen sinnlich erfahrbaren Inhalt, weil wir gewohnt sind, Katzen zu streicheln und Löwen fliehen. Sprachliche Formulierungen können sich verselbständigen und Beziehungen knüpfen unabhängig von der anschaulichen Gegenständlichkeit. Für das normale „Rauschen“ der Natur bieten physikalische Begriffe keine Erkenntnisinstrumente.
Wenn wir Wort-Laute mit körperlichen Assoziationen und emotionalen Botschaften verknüpfen können, verstehen wir sie spontan und in ihrer Lebendigkeit. Sind Begriffe und Sätze so konstruiert, dass sich solche Assoziationen nicht einstellen, braucht das Gehirn deutlich mehr Zeit, um den Worten Sinn abzuwringen. Wir müssen einen solchen Text mit seinen abstrakten Begriffen mehrfach lesen, um uns an ihn zu gewöhnen. Kategorienbildung nach rationalen Kriterien ist eine mühsam zu erlernende Kultur-Leistung. Formale Logik und deduktives Denken sind Produkte der Schriftkultur und ihrer Symbolisierungen. Sie greifen nicht auf assoziatives Wissen zurück und haben keine unmittelbar sinnlich-praktische Bedeutung. So wie die Sprache vor allem die Gemeinschaft bildenden Möglichkeiten der Kommunikation revolutioniert hat, so revolutionierte die Alphabetschrift die kognitiven Möglichkeiten des homo sapiens: Mit der Schriftform können sich Worte von ihrem handlungsorientierten Umfeld lossagen und zu willkürlichen, frei verwendbaren Instrumenten des Wirklichkeits-Bewusstseins werden.
Wenn ich meinen Blick auf den Mond fixiere, ist dies eine abstrakte visuelle Handlung: Ich identifiziere ein Muster in den Wolken als Mond, ohne dass ich praktisch überprüfen kann, was ich da „sehe“. Kindern hilft die Metapher „Mondgesicht“ über die Abstraktheit der rein visuellen Erkenntnistätigkeit.
Ein- und Zweiwortsätze sind die ersten kindlichen Versuche, über Sprache die eigene Wahrnehmung zu steuern. Substantive identifizieren die Objekte und Verben die Tätigkeiten. Die Sprache fixiert die Ergebnisse aktiver Wahrnehmung, sprachliche Benennung macht sie für das Denken und für die Kommunikation verfügbar, aufrufbar, erinnerbar.
Bedeutungen sind abstrahierende Momente eines sinnlich erfahrbaren Gegenstandes der Umwelt, eindeutige Begriffe sind mentale Konstruktionen. „Menschliches bewusstes Erfahren im Handeln und Wahrnehmen (in allen Modalitäten wie Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen) vollzieht sich nach dem Spracherwerb zunehmend in den sprachlich gegebenen Einheiten, in ihren Bedeutungen, als jenen Verknüpfungen von Handlungen, Wahrnehmungen, Bewertungen und Sprechmustern, so wie sie vom Individuum angeeignet wurden.“ (Jürgen Messing)
Die Vorteile der uneigentlichen Ausdrucksweise und das ordnende Denken
Das rationale klare Wort ist eine Illusion der Schriftkultur. Reine Formspiele wie das „3x7“ in der Mathematik scheinen ohne sinnliche Vorstellung auszukommen: „Rein sprachliches Denken ist das Musterbild gedankenlosen Denkens, das automatisch auf das schon Aufgespeicherte zurückgreift.“ (Arnheim)
Wie scheinbar klare Begriffe das Wirklichkeits-Bewusstsein prägen, zeigt die Geschichte der Kosmologie: Die Kreisform war wegen ihrer Einfachheit und Unteilbarkeit ein Denkmodell von eleganter Einfachheit und großer Verführungskraft. So stellten sich die Denker der Antike die Welt als von einem kreisförmigen Horizont umschlossene Fläche vor, über der sich der halbkugelige Himmel wölbt. Diese Weltsicht befriedigt den nach verständlicher Form suchenden Verstand so sehr, dass wahrnehmbare Erfahrungen es dagegen schwer haben. Noch Galileo Galilei verteidigte (gegen Keplers Messungen) die einfache Form des Kreises als diejenige, die göttlich sei und daher die Wahrnehmungsweise der Natur prägen müsse.
Eine andere Denkform ist die dichotomische Unterscheidung von Gut und Böse, aus der abgeleitet wird, dass die dunkle „Unterwelt“ das Reich der Toten und der bösen Geister ist.
Noch im 17. Jahrhundert hat der Florentiner Astronom Francesco Sizi gegen Galileis Entdeckung der Jupitermonde folgendermaßen argumentiert: „Der menschliche Kopf hat sieben Fenster, zwei Nasenlöcher, zwei Augen, zwei Ohren und einen Mund; so gibt es auch im Himmel zwei günstige Sterne, zwei ungünstige, zwei Leuchten und den allein unentschiedenen und anteilslosen Merkur. Daraus und aus vielen anderen ähnlichen Naturerscheinungen, die aufzuzählen zu langwierig wäre, etwa den sieben Metallen usw., schließen wir, daß die Zahl der Planeten notwendigerweise sieben ist. . . Außerdem haben schon die Juden und andere alte Nationen, wie auch die modernen Europäer, die Einteilung der Woche in sieben Tage eingeführt und diese nach den sieben Planeten benannt. Wenn wir jetzt die Zahl der Planeten erhöhen, bricht dies ganze System zusammen.“
Das ordnende Denken mit seinen konstruierten Begriffen, klar umschriebenen Typen und scharfen Unterscheidungen des Entweder-Oder ist die Brille, durch die der Mensch der europäischen Neuzeit die Natur wahrnimmt. Der Schweizer Anatom, Physiologe und Dichter Albrecht von Haller hat das im 18. Jahrhundert bei der staunenden Betrachtung der Vielfalt der Natur erkannt und so formuliert: „Die Natur verknüpft ihre Gattungen in einem Netzwerk, nicht in einer Kette; die Menschen hingegen können nur einer Kette folgen, da sie in ihrer Rede nicht mehrere Dinge zugleich vorbringen können.“ (Natura in reticulum sua genera connexit, non in catenam: homines non possunt nisi catenam sequi, cum non plura simul possint sermone exponere.)
Wildes und analytisches Denken
Die Kognitionspsychologie unterscheidet heute ein analytisches Denken, das regelhaft stattfindet und begriffliche, sprachlich fixierte kategoriale Zuordnungen vornimmt und damit einen komplexeren Kontext oft ignorieren muss, von „analogem“ Denken, das eher intuitiv, assoziativ, erfahrungsbezogen stattfindet - und kreativ, wie schon Arthur Schoppenhauer wusste (1). In der Praxis vermischen sich diese beiden Denkformen, ohne dass uns das bewusst würde - deswegen sind uns gute „Einfälle“ meist (rational, begrifflich) unerklärlich. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat die traditionell ganzheitlichen Denkweisen der naturangepassten Kulturen als „Wildes Denken“ beschrieben. Die alten Zen-Meister haben das literarisch so ausgedrückt: Gedanken „haben wie die Wolken am Himmel weder einen Ort, wo sie entstehen, noch einen Ort, wo sie verweilen“.
Auch wenn die Wort-Sprache dem Denken neue Dimensionen eröffnete, bleibt festzuhalten: „Wahrnehmungsformen sind die Grundsteine des Denkens.“ (Arnheim) Wenn das menschliche Denken sich der Worte bedient, bleibt es zumindest indirekt an die sinnlichen Wahrnehmungs-Inhalte gebunden, die den Worten erst ihren Sinn geben. Im Extremfall ermöglicht es die durch Schrift geprägte Sprache, sinnlose Wort-Formen zu konstruieren, abstrakte Begriffe „ohne Erdung“ in der sinnlichen Wahrnehmung, die für das Denken geradezu hinderlich sein können. Umgekehrt gilt: Eine bildhafte, anschauliche und lebendige Sprache hilft beim Verständnis, weil sie das Kopfkino aktiviert.
Für kreatives, produktives Denken ist entscheidend, dass die Sprache keine absolute Stabilität für das Denken und die Verständigung garantiert: Worte bleiben mehrdeutig und wandelbar. „Im Satz wird eine Welt probeweise zusammengestellt“, sagte Ludwig Wittgenstein. Ob sich die Zusammenstellung bewährt, kann ein Denken, dass sich allein in der Sprachsphäre bewegt, nicht feststellen, dazu bedarf es der geistigen Anstrengung, den Nutzen der Sätze für die Bewältigung der sinnlichen Wahrnehmung zu ergründen. Das ahnte Aristoteles, als er formulierte: „Ohne ein Vorstellungsbild (phantasia) kann man unmöglich denken.“
Das rationale klare Wort ist eine Illusion der Schriftkultur. Erst seine „symbolische Intelligenz“, sagt Ernst Cassirer, lässt den Menschen zum Kulturwesen werden: „Der Begriff der Vernunft ist höchst ungeeignet, die Formen der Kultur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen. Alle diese Formen sind symbolische Formen. Deshalb sollten wir den Menschen nicht als animal rationale, sondern als animal symbolicum definieren.“ (An Essay on Man, 1944)
Wortlaute und Schriftwörter sind Symbolisierungen, die der Wahrnehmung bei der Strukturierung des sinnlich erfahrenen Chaos helfen - und die Wahrnehmungsfähigkeit damit gleichzeitig wie in einem Bedeutungs-Gefängnis binden.
siehe auch dazu meine Blog-Texte:
Das phantastische Gehirn M-G-Link und
Vor der Sprache - Denken des Leibes, leibliches Denken MG-Link
Wie denken Menschenaffen? Denken ohne Sprache M-G-Link
Über die Entstehung von Sprache, Klatsch und Tratsch M-G-Link
„Am Anfang war Musik - über die Ursprünge von Sprache und Musik“ M-G-Link
Sehen und Denken M-G-Link
Sprache der Metaphern M-G-Link
Bilddenken, Bildhandeln M-G-Link
Über die mythischen Bilder im Kopf M-G-Link
Was ist Gedächtnis? M-G-Link
Was die Hirnforschung über die Konstruktion von Sprache weiß M-G-Link
Wie kommt der Mensch zu Bewusst-Sein? M-G-Link
Gehirngespinste oder: Wie das Gehirn Wirklichkeitsbewusstsein konstruiert M-G-Link
Schrift-Denken - Phonetische Schrift und griechisches Denken M-G-Link
Über das Potential des Mediums Schrift MG-Link
Literaturtipps:
Rudolf Arnheim, Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff
(Visual Thinking 1969, aus dem Amerikanischen übersetzt von Arnheim selbst 1977)
Dieter Lohmar, Denken ohne Sprache. Phänomenologie des nicht-sprachlichen Denkens
bei Mensch und Tier im Licht der Evolutionsforschung, Primatologie und Neurologie (2016)
Yuval Noah Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit (2014 / orig. hebr. 2011)
Gerhard Roth, Entstehen und Funktion von Bewußtsein (Ärzteblatt 29/1999, Link)
Gerhard Roth, Nicole Strüber, Wie das Gehirn die Seele macht (2014)
Raoul Schrott, Arthur Jacobs, Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren (2011)
Anmerkungen:
1) Arnheim kann sich auf eine lange philosophische Diskussion dieser Frage beziehen.
Arthur Schopenhauer formulierte 1813 in seiner Dissertation „Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde“ so:
„Jedes bloß rein vernünftige Gerede ist eine Verdeutlichung dessen, was aus gegebenen Begriffen folgt, fördert daher eigentlich nichts neues zutage… Das mit Hilfe anschaulicher Vorstellungen operierende Denken ist der eigentliche Kern aller Erkenntnis, indem er zurückgeht auf die Urquelle, auf die Grundlage aller Begriffe. Daher ist es der Erzeuger aller wahrhaft originellen Gedanken, aller ursprünglichen Grundansichten und aller Erfindungen ... Bei demselben ist der Verstand vorwaltend tätig. Ihm gehören gewisse Gedanken an, die lange im Kopf herumziehen, kommen und gehen ... bis sie endlich, zur Deutlichkeit gelangend, sich in Begriffen fixieren und Worte finden. Ja, es gibt deren, welche sie nie finden; und leider sind es die besten."
Daran anschließend Gomperz in seinen Ausführungen über „Anschauliches und begriffliches Denken“:
„Die Begriffe sind eine Art Algebra der Vorstellungen. Eine algebraische Operation aber kann kein schlechterdings neues Ergebnis liefern, sondern dieses beruth auf jenen konkreten Werten, für welche die algebraischen Zeichen eingesetzt wurden. Diese sind deshalb vortrefflich geeignet, mit gegebenen Werten rasch und leicht zu operieren. Sowie aber ein wirklich neuer Gedanke eingeführt werden soll, muß er sowohl, wie auch alle jene anderen Gedanken, zu denen er in eine neue Beziehung gesetzt werden soll, in ihrer anschaulichen Form gedacht werden."
„Wenn ich also Sätze, wie: Die Winkelsumme im Dreieck beträgt zwei Rechte; Tugend ist Glückseligkeit; Die soziale Frage steht im Vordergrund des öffentlichen Interesses, in einem Lehrbuch oder in einer Zeitung lese, so wird mir natürlich nicht einfallen, diese Begriffe und Urteile auf ihren anschaulichen Gehalt zu prüfen, sondern, ohne daß auf ihren Inhalt eingegangen würde, werden diese Begriffe und Begriffsverbindungen begrifflich lokalisiert.
Die Notiz wird nicht gelesen, sondern nach ihrer Spitzmarke dem begrifflichen Sammelkasten eingeordnet; es wird ihnen ohne Rücksicht auf die von ihnen repräsentierte Anschaulichkeit, lediglich durch ein leises Anklingen der ringsum assoziierten Begriffe, ihr psychologischer Ort angewiesen. Ein solcher Satz wird nicht nachgedacht, sondern untergebracht. Eine Unzahl solcher unentsiegelter Formeln tragen wir in uns herum, z. B. alle jene landläufigen Sätze, die in Schlagworten ein philosophisches oder politisches System andeuten wollen.“
Und:
„Das begrifflich oder diskursive Denken … kann nur dazu dienen, das anschauliche Denken abzukürzen, zu erleichtern, zu vertreten. Es empfängt seinen Wert aber allüberall erst vom Wert der vertretenen Anschaulichkeit. Je höher die Abstraktion, auf einer desto höheren Warte steht, einen desto höheren und umfassenderen Überblick über die Anschaulichkeit vertritt sie. Darauf beruth die Täuschung, der PLATON und seit ihm ungezählte Nachfolger erlagen, wenn sie die Beschäftigung mit den Abstraktionen, z. B. mit der Mathematik, als ein Leben in einer höheren Welt empfanden und diese Welt fälschlich als die der reinen Begriffe definierten, während sie in Wahrheit die der höchsten Erhebung und Zusammenfassung des Anschaulichen ist. Vielmehr, daß ein Denken in Begriffen vor sich gehen, d. h. daß es die Worte statt der Dinge gebrauchen muß, ist und bleibt immer ein Notbehelf. Und je mehr sich deshalb ein Denken in reinen Begriffen, d. h. Worten bewegt, desto hohler und leerer ist es. Der wahren Genialität, welche das Maximum der praktisch möglichen Annäherung an die theoretisch denkbare, vollkommene Erkenntnis darstellt, wird dich ein jeder selbst umsomehr annähern, je bestimmter und genauer sein Denken aus der anschaulichen Erfahrung erwächst und ihr treu bleibt. Und in diesem höheren Sinne, nämlich in Beziehung auf ein wahrhaft schöpferisches Denken, können wir uns den Satz des Aristoteles mit einer leichten Änderung aneignen: „Ohne Phantasie ist es unmöglich rational zu sein.“
Heinrich Gomperz, Zur Psychologie der logischen Grundtatsachen, Leipzig und Wien (1897)
online verfügbar: http://www.gleichsatz.de/b-u-t/spdk/wk/gomperz-f.html
2: „Wortlausen“ – so übersetzt der Schweizer Sprachforscher Urs Boeschenstein die These von Robin Dunbar, vgl. Robin Dunbar: Klatsch und Tratsch. Wie der Mensch zur Sprache fand (1998),
Boeschenstein über die Frühformen des sozialen Denkens bei Primaten:
„Jane Goodall, die Primatenforscherin, die Schimpansengruppen über Jahre beobachtete, erzählt die Geschichte von Mike, einem kleinen, eher schwachen aber gescheiten jungen Schimpansenmann. Eines Tages nahm Mike zwei Metallbehälter, in denen Jane Goodall ihren Brennstoff zum Kochen aufbewahrte, und begann sich damit Aufmerksamkeit zu verschaffen. Er machte Krach. Das tun Schimpansen, wenn sie um Rang streiten, indem sie Äste heftig bewegen oder sich auf die Brust trommeln. Mike machte Lärm mit Kerosinbehältern und erreichte, dass ihn die übrigen Männer als obersten Krachmacher akzeptierten. Er schaffte es, sich die dominante Position in der Männerhierarchie zu erobern. Mike war offenbar ein ‚gescheiter’ Affe.
Was musste Mike denken können, um seine Strategie zu planen? Bevor Mike die Benzinkanister zum Stärkesignal umfunktionierte, hatten schon andere Schimpansen mit den leeren Trommeln gespielt. Aber Mike gelang es, sich eine Vorstellung zu machen, welchen Effekt er mit seinem ‚display’, mit seiner Veranstaltung, erreichen könnte. Er plante seine Handlung und konnte Wirkungen vorausberechnen. Er war in der Lage, sich vorzustellen, wie seine Handlung auf andere wirken würde, er konnte sich die Reaktion der anderen vorstellen. ‚Social event perception lies at the core of chimpansee social intelligence’ , schreibt Merlin Donald in seinem Buch über die Ursprünge der Denkfähigkeit des modernen Menschen. Die Fähigkeit, Ereignisse als Einheiten wahrzunehmen und solche Ereignisse im Kopf zu planen, ist die Grundlage der sozialen Intelligenz der Schimpansen. Aus dieser Fähigkeit konnte Kultur wachsen, das gelernte und tradierte Wissen einer Gruppe. (…)
Die Gehirne dieser Vorfahren konnten ‚Episoden’, ganze Sequenzen von Ereignissen speichern, und sie konnten diese Abläufe von Erinnerungen zum Nachdenken brauchen, sie konnten ihre Erfahrungen nach den Maßstäben ihrer Gefühlssprache ordnen. Sie hatten gelernt, Erfahrungen zu bewerten, und sie bewerteten nach einer gemeinsamen Ordnung von Werten: Ausgleich, Gleichgewicht, Gleichheit, Miteinander, Miteinanderteilen, Miteinanderleben, Freuen, Trauern, Lachen, Weinen - miteinander.“
(nach: Boeschenstein, Mensch und Sprache. www.boeschenstein.ch, Zugriff 4-2014)
|

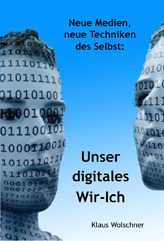
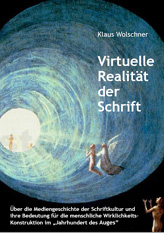
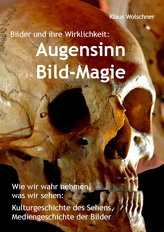
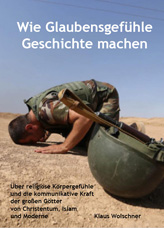


 Dinge, die benannt sind, scheinen bekannt zu sein, sind einsortierbar – und provozieren deutlich weniger Neugier als unbenennbare Phänomene. Phänomene, die nicht durch das Gitter der sprachlichen Fixierungen betrachtet werden können, erscheinen dem Bewusstsein fremd, einzigartig
Dinge, die benannt sind, scheinen bekannt zu sein, sind einsortierbar – und provozieren deutlich weniger Neugier als unbenennbare Phänomene. Phänomene, die nicht durch das Gitter der sprachlichen Fixierungen betrachtet werden können, erscheinen dem Bewusstsein fremd, einzigartig