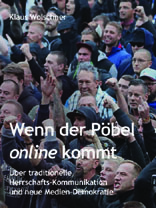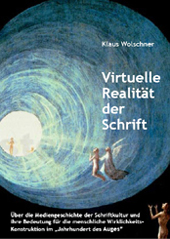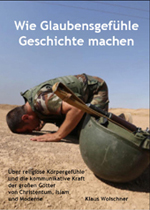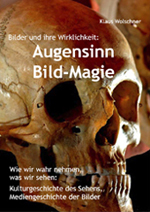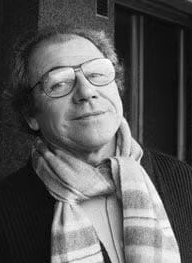|
Zu Jean Beaudrillard
Jean Baudrillard (1929-2007) Moderne Gesellschaften werden nicht von der Produktion, sondern vom Konsum geprägt. Während der Gebrauch von Dingen seine Grenze im vollen Bauch findet, kennt der Konsum der Zeichen keine Grenzen. Die Dinge lassen sich als Zeichen beliebig konsumieren, ohne an soziale oder materielle Realitäten gebunden zu sein. Das war ein Gedanke der Situationistischen Internationale, die der französische Künstler und Philosoph Guy Debord als „Gesellschaft des Spektakels“ (1967) identifiziert hatte. Beaudrillard teilte allerdings nicht Debords Anarchismus, der die Masse der Menschen, die das Spektakel lieben, von ihrer Illusion befreien wollte. Mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 begrüßte Baudrillard allerdings den islamistischen Fundamentalismus als einen Protest gegen den westlichen Konsum-Fetischismus. 1970 setzt Beaudrillard seine Überlegungen in dem Buch „La société de consommation“ fort. Er ist inzwischen Assistent bei Henri Lefebvre in Nanterre. Baudrillard präsentiert sich von einer vergleichsweise ‚wissenschaftlichen‘ Seite. Er analysiert die „Wegwerfzivilisation“, die „Sakralisierung“ des Körpers als Konsumobjekt und die die „therapeutische Gesellschaft“, die die psychischen Folgeschäden des Konsums verwaltet. Die Warenberge in den Schaufenstern und in den Wohnzimmern sind Teil eines kulturellen Zeichensystems. Sie symbolisieren das „Glück“ des Konsums, der zum säkularen „Äquivalent des Heils“ wird. Kulturkritik des digitalen Zeitalters In der schönen neuen virtuellen Welt lassen sich Schein und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten, erklärt Beaudrillard in „Der symbolische Tausch und der Tod“ (frz. „L'échange symbolique et la mort“, 1976). Das Reale ist in der medial erzeugten Hyperrealität aufgegangen, so erklärt Jean schon 1976. In der Kultur der Hyperrealität hat der Tod kleinen Platz mehr, Sterben und die Toten werden ghettoisiert. Beaudrillard: „Das Reale ist tot, es lebe das realistische Zeichen!“
|
|||