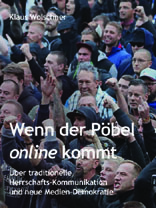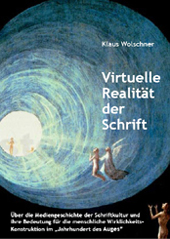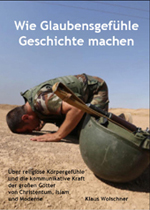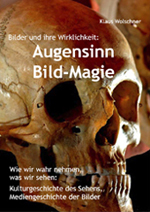|
Krisendiskurs „Warenhaus“ um 1900 Am Ende des 19. Jahrhunderts entfaltete sich im Streit um die großstädtische Konsumkultur 2024 n Die Bedeutung der großstädtischen Konsumkultur, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts im Warenhaus symbolisierte, wird verständlich vor dem Hintergrund der sozialen Kleiderordnung, die in der frühen Neuzeit geherrscht hatte. In traditionalen ländlichen Gemeinschaften findet der Austausch von Waren in einem engen Netzwerk sozialer Beziehungen statt. Den Rahmen setzen soziale Vorschriften, die über Gebräuche, Abhängigkeiten und Traditionen verbindlich sind. Ausgetauscht mit Verwandten und Bekannten wird zudem nur das, was lokal produziert werden kann. „Policeyordnungen“ für standesgemäße Kleidung Um 1530 legte die für den Raum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verbindliche „Reichspoliceyordnung“ fest, welchem Stand welche Kleidung zustand. Bürger durften demnach weder Samt noch Seide tragen. Maximilian I. von Bayern vertrat noch im 17. Jahrhundert die Ansicht, zu viel Eitelkeit stehe den unteren Ständen nicht zu. „Vorwitzige Frauen und Jungfrauen“, die es trotz der Kleiderordnung wagten, gegen ihren Stand seidene Schürztücher zu tragen, sollten bestraft werden. Offenbar waren die Policey-, Luxus- oder Kleiderordnungen aber wenig erfolgreich. Sie mussten laufend neu beschlossen und verkündet werden. In der Augsburger Kleiderordnung von 1530 etwa heißt es: Die Nürnberger Kleiderordnung legte 1568 fest: „Es sollen hinfür die jungen Gesellen und Mannsbilder keine Hosengesäße machen lassen mit langen, plundernen Schnitten und Unterfuttern, die ihnen über die Knie und Waden hinabhängen; sondern welche zerschnittene und unterzogene Hosen tragen wollen, die solllens nicht länger machen lassen, als das die Schnitte samt Unterfutter eine gute Handbreit oberhalb dem Knie ihre Endschaft haben und darüber nicht herabhängen.“ Solche Kleiderordnungen gab es in allen Herrschaftsgebieten Europas zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert verloren sie vollends ihre Bedeutung. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine öffentliche Debatte über die Frage, was es bedeuten würde, wenn vor allem in den Großstädten die überholten sozialen Grenzen mit Kaufkraft überwunden werden können. Sombart, Simmel - zeitgenössische Soziologie der Modernisierung Der Soziologe Werner Sombart (1863-1941) beschrieb die Modernisierung vor allem als Niedergang und Zerfall. Reklame als typischer Ausdruck der Moderne führe zur Verwüstung des Stadtbildes und zur Verrohung des Geschmacks: „Die Kunst im Dienste der Reklame ist eine der vielen gründlichen Verirrungen unserer Kultur.“ Dagegen polemisiert der Karikaturist, Plakatmaler und Werbetexter Edmund Edel, die Reklame sei ein „Kulturfaktor“ und Ausdruck moderner Urbanität: „Ist ein rauchender Fabrikschlot nicht ebenso wertvoll für unsere Kultur, wie die polierten Fingernägel oder die seidenen Unterbeinkleider eines Westenschnittästheten?“ Der Kulturphilosoph und Soziologe Georg Simmel (1858-1918) hat schon früh die Frage nach der durch Konsum induzierten Individualisierung gestellt. Schon Jahre vor seiner „Philosophie des Geldes“ (1900) hatte Simmel unter dem Pseudonym Paul Liesegang einen Essay über die „Infelices possidentes“ veröffentlicht (Zeitschrift „Die Zukunft“, 1893). Er beschreibt die neuen Unterhaltungs- und Konsumangebote Berlins, den „hohlen Prunk modernster Vergnügungen“. Warenautomat und das Warenhaus sind die Sinnbilder einer Vergnügungskultur, die die Menschen, die aus ihren alten Bindungen herausgelöst worden sind, überfordert. „Wechselnde Rollenanforderungen, die Lösung von Traditionen und sozialen Bindungen und das Verschwinden eines einheitlichen Erfahrungsraums sind für Simmel die negativen Konsequenzen der Moderne.“ (Lanz) Diese Menschen müssen ihre Identität selbst finden. Und sie suchen Identität in dem Warenangebot. Gefährliche Freiheit der Frauen Die Warenhäuser und die seit der Jahrhundertwende entstehenden Lichtspielhäuser waren auch Thema populärer Kritik – in Fachzeitschriften und in Romanen. Warenhaus und Kino waren die öffentlichen Orte, an denen sich moderne Frauen ohne ihre männliche Begleitung treffen konnten – sie waren eine willkommene Abwechslung vom häuslichen Alltag und boten Teilhabe an der großen Welt. Im Warenhaus konnten Frauen sich wie in einem großen Spiegel mit anderen Kundinnen vergleichen, es waren Bühnen des Schauens. Auch der Stummfilm war in den ersten Jahren „weiblich“, wie Heide Schlüpmann beschreibt, und lockte vor allem ein weibliches Publikum. Die Konsumindustrie verkaufte mit den Waren auch Illusionen, Träume und Geschichten. Viele Groschen- und Heftromane des frühen 20. Jahrhunderts spielten im Filmmilieu und bedienten die Phantasien von jungen Mädchen, die davon träumten, selbst auf der großen Leinwand zu erscheinen. Sie thematisieren Aufstiegsphantasien und gleichzeitig die Kritik an der modernen Konsumgesellschaft, in der der Mensch konsumierbar und somit austauschbar wird. Als Schauspielerin konnte die junge Frau ihr schönes Gesicht verkaufen, als Verkäuferin ihre Kundinnen mit ihrer Schönheit locken. Die neue Freiheit der Frauen betraf auch ihr Liebesleben, das in den Groschenromanen beschrieben wurde. Die männlichen Kritiker sahen in den beiden Institutionen vor allem die Verführbarkeit und Beeinflussbarkeit der Frauen. National-sozialistische „Lösung“ des Modernisierungs-Konfliktes Die Verbindung von Liebe, Käuflichkeit und Konsum zieht sich auch durch den Kinoroman ‚Die Kinoprinzess. Geschichte eines armen Mädels‘ von Franz Scott (1913). Das arme Mädchen Grete erfährt, dass jedes Geschenk, jede Leistung, sei es eine neue Pleureuse für den Hut, ein Essen oder ein Kinobesuch eine Gegenleistung erfordert. Aufgrund der großen Zahl jüdischer Kaufleute ließ sich das Thema leicht mit dem Antisemitismus verbinden - Juden sind die Verführer. Die Warenhaus-Trivialliteratur schildert sie als „Spekulanten“, die „auf orientalische Art“ Raubzüge unternehmen. Theodor Fritsch kontrastierte 1887 in seinem „Handbuch der Judenfrage“ den „ehrlichen deutschen Kaufmann“ mit dem „Warenhausjuden“, der insbesondre mit Reklame die Käufer verführe. Insbesondere in dem populären Trivialroman ‚Der Warenhauskönig‘ (1912) von Max Freund kommt gleichzeitig die Faszination zum Ausdruck: „Was für Hallen! Welche Pracht! Gewaltige Marmorpfeiler schnellen empor. Die Kuppeln blitzen und funkeln in wunderbarer Beleuchtung. Das Licht ergießt sich breit und gewaltig über die Räume. Man kann es kaum fassen, daß diese wunderbaren Lichthallen zu prosaischen Verkaufszwecken ausersehen sind.“ Freund propagiert dabei einen deutsch-nationalen Sozialismus, der erreichbar sei, wenn die Macht der Juden und die der Banken gebrochen werde.
|