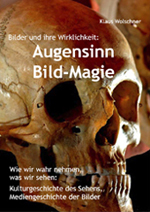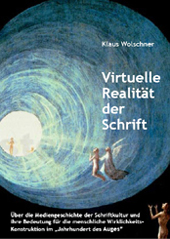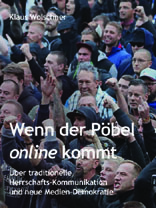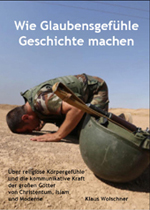|
Lese-Vergnügen, Kino-Lust 2020 n zu AS7 Am Ende des 20. Jahrhunderts entwickelten die Unterschichten in Deutschland im Zusammenhang mit den illustrierten „Massenmedien“ ein Vergnügen am Lesen. Gekauft wurde einfacher Lesestoff, der den Traum vom Schönen im Leben nährte. Groschenhefte boten für wenige Pfennige regelmäßig „Süßes für die Psyche“. Diese neue Lese-Lust ging in die Kino-Lust über. „Schund“ und „Kitsch“ schäumten die Verteidiger der bildungsbürgerlichen Kultur-Privilegien. Kommunikation aus Austausch sinnenhafter Gefühle Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Nachrichten zu dienen, viel bedeutsamer aber ist der „Subtext“, der Austausch sinnenhafter Gefühle. Kommunikation transportiert Assoziationen des Schönen im Leben und ein Einvernehmen darüber fördert die sinnliche Glückseligkeit. Deswegen „Tratschen“ wir so gern. Der bäuerliche Traum vom guten Leben Der „Hunger nach Schönheit“ im Leben ist durchaus ein Phänomen der Massenkultur, ästhetische Erfahrungen gehören auch für die jeweiligen „Unterschichten“ zu den Vorstellungen von einem guten Leben. Die Vergnügungen des bäuerlichen Pöbels galten in der Kulturgeschichte als „unästhetisch“ und körperlich-roh – aber nur aus der Perspektive derer, die die Ordnung des Wissens darüber festlegen wollten, was schon „Kultur“ ist und was noch zivilisiert werden muss. Proletarische Massenkultur in der Großstadt Verlockend für das Volk waren die neuen medialen Techniken. Am Ende des 19. Jahrhunderts wird das in der Ökonomie der Massenmedien deutlich – die illustrierten Geschichten boten Anreize für die ästhetische Einbildungskraft. Was von der bürgerlichen Kultur als „Schund“ diskreditiert wurde, war für das Volk attraktiv als Möglichkeit einer „Ästhetisierung des Alltags", bei der Vorstellungen vom schönen Leben genussvoll entwickelt und ausgetauscht werden konnten. Die neue Massenkultur des späten 19. Jahrhunderts ist ein Element einer kulturellen Demokratisierung. Schon bei den Wahlen zum Deutschen Reichstag (1871) hatten alle Männer ab 25 Jahren ein allgemeines gleiches Wahlrecht erhalten, das hatte große symbolische Bedeutung. Während im bürgerlichen 19. Jahrhundert die Kultur der Selbstvergewisserung einer kleinen, homogenen Führungsschicht diente und neben den familiären Verbindungen die humanistische Ausbildung den Zugang zu hohen Stellungen ermöglichte, bietet die Massenkultur der Jahrhundertwende den städtischen Unterschichten für die wachsenden Freizeit und Kaufkraft ein Angebot des „ästhetischen Genusses“ (Maase). Der „vierte Stand“ entwickelte einen Anspruch auf Kunst und Vergnügen und löste sich von der Bevormundung der Volksschul-Bildung. Misstrauisch wurde das „von oben“ verfolgt. Kaiser Wilhelm II. warnte in einer Kronratsrede 1890 davor, dass die „Beschränkung der Arbeitszeit auch die Gefahr der Förderung des Müßiggangs“ bedeute. Der sinnlich-ästhetische Genuss wurde zum Element des Alltags der einfachen Leute, die einen Anteil an ihrem kleinen Reichtum, in harter Arbeit verdient, für kräftige Vergnügungen ausgaben und damit Träume und außerordentliche Gefühle in das alltägliche Leben bringen wollten. In ihrer Freizeit eigneten sich die Unterschichten die neuen Medien an, dazu gehörten in erster Linie Fotografie, Massendrucksachen und dann Kino, und da diese neuen Medien als rein kommerzielle Unternehmungen organisiert waren, mussten sich die Verkäufer nach dem Geschmack der Massen richten. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich Kräfteverhältnis zwischen der Kultur der „einfachen Leute“ und der kulturellen Eliten umgekehrt – die populäre Kultur war zur dominanten Kultur geworden. Populären Vergnügungen gehörten seitdem zur kulturellen Grundversorgung aller, alle befassen sich mit denselben Werken und sehen dieselben Filme. Die elitäre bürgerliche Kultur findet sich in eine Nische abgedrängt, im Fernsehen auf Spartenkanäle und in die späten Abendstunden. Im ausgehenden 19. Jahrhundert äußerten sich die Bemühungen, die sozialen Unterschiede zu verteidigen, noch in demonstrativ abwertenden Diskursen gegen Schmutz und Schund. Die Träume der Unterschichten wurden als Kitsch empfunden und verurteilt. Offenbar fanden die Vertreter der elitären Kultur es bedrohlich, dass wachsende Bevölkerungsteile eine eigene, ihnen unzugängliche und fremde Praxis des ästhetischen Genusses entwickelten. Noch 1912 stellte ein Pfarrer fest, der durchschnittliche Gebildete komme eher einmal nach Afrika als in die Arbeiterviertel an den Rändern der Großstädte. Aber Arm und Reich begannen sich bei Radrennen und Flugvorführungen zu begegnen. Massendrucksachen Der Erfolg von Familienblättern wie der Gartenlaube (seit 1853, Auflage 1876: 382.000) dokumentieren die Entwicklung. 1885 wurde die erste - ausdrückliche und vom Titel her exklusive - Frauenzeitschrift gegründet: „Dies Blatt gehört der Hausfrau“. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts war die Anzahl derer gewachsen, die über elementare Lesefähigkeiten hinaus einfache kurze Texte regelmäßig und mit Genuss konsumieren konnten, denen das extensive Lesen also nicht nur ein Bildungserlebnis versprach, sondern auch Vergnügen bereitete. Neben der Alphabetisierung war dafür der Zugewinne an freier Zeit entscheidend. Solche Medienangebote waren im ausgehenden 19. Jahrhundert eine Quelle des Vergnügens, denn sie boten Einblicke in unbekannte Welten, sie waren voller Anregungen für phantasievolle Tagträume im Vergleich mit den eigenen Erfahrungen und Wünschen. Zudem boten sie Gesprächsanlässe mit anderen. Insbesondere die „illustrierte“ Presse gewann einen festen Platz in den Arbeiterfamilien. Dem Lesebedürfnis entsprach die neue Generalanzeigerpresse, die nicht mehr politisch motivierte Parteipresse sein wollte und rein kommerziell auf eine möglichst große Leserschaft ausgerichtet war. Die Tour de France ist 1903 von der Zeitschrift L’Auto initiiert worden, große Berliner Zeitungen stifteten Fußballpokale und veranstalteten Autorennen. Wenn die Auflage der deutschen Zeitungen im Jahr 1910 auf 15 bis 18 Millionen geschätzt wird, dann bedeutet das bei einer deutschen Bevölkerung von 68 Millionen Menschen, dass praktisch jedermann erreicht wurde. Große Bedeutung unter den Massendruckwerken hatten auch die Groschenhefte. Sie boten für wenige Pfennige regelmäßig „Süßes für die Psyche“ (Maase). Insbesondere Heranwachsende sammelten und tauschten solche Groschenhefte, tauschten sich darüber aus und übernahmen spielerisch Rollen von Serienfiguren. Sie identifizierten sich mit ihren Heldenfiguren wie Nick Carter oder mit den Luftpiraten. Film und Kino Der Film begann 1895 als visuelles technisches Wunder-Medium und machte zubnächst Karriere in der Subkultur des Varietés. Schon die ganz frühen Kurzfilm-Streifen zeigten, dass Phantasiereisen besonders beliebt waren. Die „Versuchung des Heiligen Anthonius“ oder die „weiße Sklavin“ („Den hvide Slavinde“, 1906) führten sexuelle Phantasien vor Augen, die „Reise zum Mond“ technische Phantasien. Die bürgerliche Kritik an dem Vergnügen des „Pöbels“ an den Filmvorstellungen in abgedunkelten Räumen zeigt, wie sehr diese „Suche nach dem Schönen“ auch immer eine unsublimierte körperliche Komponente hatte. (MG-Link) Schon wenigen Jahren entwickelte sich angelehnt an das Theater das Format des „Spielfilms“. Als erzählender Film wurde das neue Medium zum Massenmedium auch für bürgerliche Kreise. Bereits 1914 war die die Zahl der Sitzplätze in den neuen „Lichtspieltheatern“ pro Kopf der deutschen Bevölkerung mit der heutigen Kino-Dichte vergleichbar. Schon im Stummfilm entwickelte sich eine Kultur der Filmstars. Der russische revolutionäre Leo Trotzki hat 1923 festgestellt, dass einzig die Fantasiereisen des Films für sein proletarisches Klientel eine Konkurrenz zu denen der Kirche bieten könnten. Erst in der Fernsehgesellschaft genießt der Mensch einsam auf seinem Sofa die Massen- oder Populärkünste – und das, jedenfalls statistisch gesehen, fünf Stunden täglich. Die Virtual-Reality-Brille vervollkommnet die körperliche Einsamkeit und verlegt die aufregendsten und schönsten Abenteuer ganz in die Einbildungskraft. Die Bedürfnisse nach körperlich erlebbarer Ästhetik sind damit nicht erledigt, sie suchen sich andere Felder.
Lit.: Kaspar Maase, Grenzenloses Vergnügen: der Aufstieg der Massenkultur 1850-1970 (1997)
Zur Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts siehe auch die Texte: |