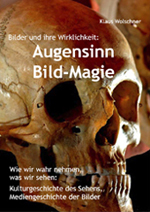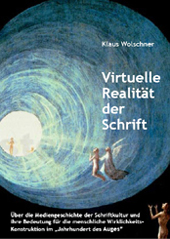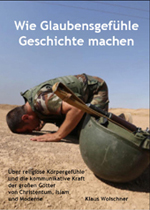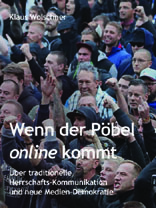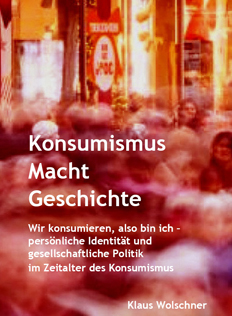|
Medienpraxis: Autobiografische Erzählungen Eine autobiografische Erzählung hat ein „ich” - ein mehr oder weniger literarisch geformtes Ich. LeserInnen erwarten besonders authentisch konstruierte Einblicke in das Innere, die Gefühlswelt der Ich-ErzählerIn. Ansonsten gelten für autobiografische Erezählungen dieselben Faustregeln, die für Texte allgemein gelten.
siehe meine anderen medienpraktischen Tipps |
|||