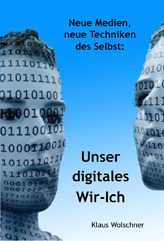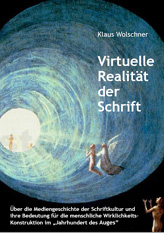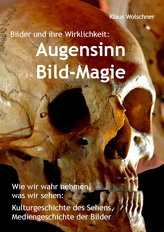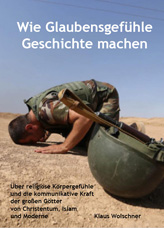|
Zu McLuhan 2020/2013 „Magier des Medienzeitalters“ nannte der Wiener Medienwissenschaftler Frank Hartmann im Jahre 2001 den kanadischen Medientheoretiker Marshall McLuhan, der damals 90 Jahre alt geworden wäre. McLuhan, geboren 1911, ist im Dezember 1980 gestorben, erlebte also nicht mehr die Entwicklung des „WWW“ zu einem Massenkommunikationsmittel. Umso erstaunlicher seine visionären Thesen. Seine große Bücher erschienen in den 1960-er Jahren. Die Urteile über Marshall McLuhan reichten damals schon von offener Verehrung bis hin zu vollkommener Ablehnung. Als Clown wurde er bezeichnet, als ein Prophet oder Utopist, als Wirrkopf. Die europäischen Medienwissenschaftler empfanden ihn als zu „popartig" und nicht wissenschaftlich genug. Seine seltsame Verquickung von Marketing-Sprache, östlicher Lebensanschauung und europäischer Kulturkritik stieß auf Ablehnung. McLuhan denkt in Kreisen und Spiralen, in Blumenmustern und Mandalas und sperrte sich ausdrücklich gegen das systematische logische Schriftsprachen-Denken. McLuhan nannte seine eigene Methode „perceptual, not conceptual" - wahrnehmend, nicht begrifflich. Hans-Magnus Enzensberger fand McLuhan nicht politisch genug. Dass manche von McLuhans genialen Würfen aus heutiger Sicht deutlich daneben gingen, schmälert sein Verdienst in Bezug auf die moderne Medienkommunikations-Theorie nicht. Was McLuhans kennzeichnet, ist sein Ideenreichtum. Er versuchte in der frühen Zeit des Fernsehens im Kontext seiner Zeit und eines „katholischen” Denkens, die von ihm erspürten mediengeschichtliche Entwicklung zu umkreisen und zu begreifen. Zentral für McLuhan war die These vom Niedergang der über einige Jahrhunderte prägenden Buchkultur durch die neue elektrische Medienkultur. Das „Ende der Gutenberg-Galaxis“ war für ihn der Beginn eines neuen Zeitalters, in dem „die gesamte menschliche Familie zu einem einzigen globalen Stamm verschmolzen wird". Mit der Fixierung auf Schrift- und Druckkultur, so McLuhan, unterdrückte das literal gebildete bürgerliche Individuum ganze Welten von sinnlichen Bedeutungs- und Wahrnehmungsinhalten, deren mögliche Rückeroberung durch die neuen Medien möglich werden würde. „We return to the inclusive form of the icon": Eine Kultur der Bilder und der Benutzeroberflächen, so seine Hoffnung, würde weniger elitär sein als die Kultur der Schriftgelehrten. Als der kanadische Ökonom Harold Innis Ende der 40er Jahre verkündete, „dass der Gebrauch eines bestimmten Kommunikationsmediums über einen langen Zeitraum hinweg in gewisser Weise die Gestalt des zu übermittelnden Wissens prägt", nahm das in der Kommunikations-Theorie niemand wahr. Anfang der 60er Jahre wurde McLuhan mit seinem „The medium is the message" in bestimmten Kreisen der USA zu einer Kultfigur. Dabei begann McLuhan ganz klassisch kulturkritisch: „Wir leben in einem Zeitalter, in dem zum ersten Mal Tausende höchst qualifizierter Individuen einen Beruf daraus gemacht haben, sich in das kollektive öffentliche Denken einzuschalten, um es zu manipulieren, auszubeuten und zu kontrollieren.“ (McLuhan, 1951) 1962 erschien dann „The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man“, 1964 „Understanding Media: The Extensions of Man“. Von einer Kritik der Alltagskultur bewegte sich McLuhan zu einer Kritik der Buchkultur vom Standpunkt der neuen elektronischen Wahrnehmungsästhetik. 1967 brachte Newsweek den exzentrischen kanadischen Professor als den „weltweit meist diskutierten Intellektuellen“ auf ihre Titelseite. The medium is the Message. Das Medium ist die Botschaft. So lautete die populäre Grundthese McLuhans, die er im Jahre 1958 wiederholt vor allem in Vorträgen und Interviews äußerte. Der Begriff „Botschaft“ zielt normalerweise den Inhalt. McLuhans provozierende Formel will den Blick frei machen für die Form, für die Art und Weise, wie der Mensch durch seine Medien geprägt wird: McLuhan bezeichnet die orale Kultur als eine „Welt des Ohres", da der Mensch, der nur über das Medium der gesprochenen Sprache verfügt, im akustischen Raum lebt. Das Ohr ist das wichtigste Sinnesorgan. Den Stammesverband oraler Kulturen charakterisiert McLuhan als Geflecht totaler gegenseitiger ‚Abhängigkeit und Wechselbeziehung', das Individualität ebenso wenig zulässt, wie das Gehör einen einzelnen Ton aus Geräuschen isolieren kann. Das neue Medium Schrift führt den Menschen aus dem Stammesdasein in die Zivilisation, gibt ihm „ein Auge für ein Ohr". Dies leistet jedoch erst das phonetische Alphabet, da hier - im Gegensatz zu Hieroglyphen oder Ideogrammen - das einzelne Zeichen bedeutungslos ist. Für den, der liest, wird die Dominanz des Ohres beseitigt, da die Betonung nun auf der visuellen Komponente liegt. Natürlich galt das nur für eine in der Schriftkultur gebildete Elite, nach dem Ende der antiken griechisch-römischen Kultur nur für eine klösterliche Elite. Erst im Gutenberg-Zeitalter kann das neue Medium Schrift, durch den Druck verallgemeinert, die Bereiche des Wissens, des Staates, der Produktion und des Individuums prägen. Die Vielfalt der Sinnesempfindungen in der menschlichen Kommunikationskultur wird die Konzentration auf die visuell aufnehmbare Botschaft verdrängt, der Körper muss für dieses Medium diszipliniert werden. Vermittelt durch die neue Kultur des Buchdrucks entstand eine neue Schrift-Sprache mit festen Regeln der Orthographie und Grammatik. Gedanken können fixiert und mit anderen fixierten Gedanken verglichen werden, Gedankengebäude werden denkbar, Wissenschaft entsteht. Bilder werden zu Hilfsmitteln der verbalen Beschreibung. „Ohne eine Technik, die danach strebt, Erfahrungen einem homogenisierenden Prozess zu unterwerfen, kann es eine Gesellschaft kaum je zu einer Herrschaft über die Naturkräfte oder auch nur zu einer Organisation menschlicher Anstrengungen bringen." Folge des medialen Umbruchs ist eine Abtrennung des Gefühl vom Verstand – und die Abwertung des Gefühls. Irrationalität und Dunkelheit werden als Feind der auf Rationalität und Visualität ausgerichteten Kultur ins Unterbewusste abgedrängt. McLuhan bezeichnet den klassisch gebildeten, zivilisierten Menschen als ein Wesen, das nur als Schatten oder Bruchteil seiner selbst existiert und in der Enge der Uniformität und in dem Dunkel des Unterbewussten haust. Gewaltige Fortschritte wurden um den Preis einer schriftsprachlichen Disziplinierung des Denkens erzielt. Für McLuhan entspricht der Charakter dieses Denkens dem einer „logischen Maschine". Die gedruckten Bücher klassifizieren die Welt, um sie zu analysieren, versehen sie mit Zahlen und Indizes, vermessen die Welt. Die gewaltige Dynamik der Industriegesellschaft ruht auf dem Buchdruck, weil er die Bedingungen schuf, die Welt als messbar und analysierbar wahrzunehmen. Dieser Prozess vollzieht sich im Gutenberg-Zeitalter völlig unabhängig von der Frage, was in dem einen oder anderen Buch gedruckt wird und was Kinder in ihren Schul-Fibeln gerade lernen.
Elektrizität macht das globale Dorf zum menschlichen Lebensraum Wie beim Buchdruck dem Medium als Form die verändernde Kraft innewohnt, so ist auch von den elektrischen Medien, so McLuhans Überzeugung, eine völlige Veränderung der menschlichen Kommunikationskultur zu erwarten. Das Buch als Leitmedium wird von den elektronischen Medien beerbt. Im Aufkommen der Elektrizität sieht McLuhan den Anfang eines neuen Zeitalters. „Die ‚Botschaft’ jedes Mediums oder jeder Technik ist die Veränderung des Maßstabes, Tempos oder Schemas, die es für die Existenz des Menschen mit sich bringt.“ Das Medium ist die Massage, „weil eben das Medium Ausmaß und Form des menschlichen Zusammenlebens gestaltet und steuert“. McLuhan begriff die Medien als „extension of man". Medien schaffen neue symbolische Ebenen und generieren völlig neue Umwelten - „The new media are not bridges between man and nature, they are nature". Medien geben die Wirklichkeit nicht wieder oder vermitteln sie, sondern definieren diese erst. McLuhan versteht als „Medium“ nahezu alle Artefakte, wie z.B. Schrift, Kleidung, Geld oder elektrisches Licht. Er sieht in ihnen eine Ausweitung des Menschen und seiner natürlichen Sinne. Durch sie werden neue Dimensionen von Zeit und Raum zugänglich. Das psychische und soziale Gefüge verändert sich, beeinflusst durch die medialen „Ausweitungen von z.B. der Haut, der Hand oder des Fußes". Dauerte es beispielsweise früher Wochen, einen Brief zu versenden, geschieht dies heute in Sekunden per Email über das Internet. Das Miteinander der Menschen verändert sich dadurch. Aktion und Reaktion erfolgen fast gleichzeitig.
Das Zentralnervensystem des Menschen bildet den gesamten Körper auf der Großhirnrinde ab. Von den Augen über die Ohren bis zum großen Zeh findet sich dort alles repräsentiert. Das ist unmittelbar einleuchtend, denn anderenfalls hätten wir kein Bewusstsein von unserem Körper. Wir hätten dann nicht einmal den Begriff des Auges oder des Ohres in unserer Sprache. Das Problem ist aber, dass die Bevölkerung weiterhin noch auf die Art und Weise denkt, wie sie es schon vor dem Zeitalter der Elektrizität getan hat. Bei Siegmund Freud wird dies bei dem Kerngedanken seiner kritischen Kulturanalyse deutlich: „Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht großartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich noch viel zu schaffen." (Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, 1929) Erkennt der Mensch sich in seiner Technik nicht wieder, bleibt sie ihm fremd. Er kann seine „Prothesen" (Freud) nicht beherrschen, sieht sich ihnen ausgeliefert. McLuhan geht von dem Gedanken aus, dass die Techniken, Werkzeuge und Umgebungen großen Einfluss auf den Menschen und dessen sinnliche Wahrnehmung haben. Er entwickelt für den neuen Denk- und Wahrnehmungsstil den Begriff vom „globalen Dorf" (global village). Durch die globale elektrische Vernetzung der Menschen wird die Wahrnehmung von Raum und Zeit neu definiert, Distanzen aller Art werden aufgehoben, die Welt wird zusammengezogen. Es ist ein anderer Mensch, eben ein elektronisch ausgeweiteter Mensch, der in dem kommunikativ hergestellten „globalen Dorf" lebt. Das „globale Dorf" ist der virtuelle Schauplatz des elektronischen Spektakels. Ein sensationelles Ereignis, das dies wenige Jahre nach der Veröffentlichung von McLuhans Gedanken vorführte, war Live-Übertragung von der Mondlandung der Apollo-Astronauten am 20. Juli 1969. Die Bilder vereinten 500 Millionen Menschen rund um den Globus vor den Fernsehbildschirmen, der Mond erschien nicht mehr als fern leuchtender Punkt, um dessen Interpretation sich Astronomen und Astrologen bemühten, sondern als betretbare Krater-Oberfläche. Im Kommentar zu den Bildern wurde behauptet, dass es sich nicht eine der vielen Fiktion-Serien handele, sondern um ein Abbild von Realität. Ein sensationelles Ereignis, bei dem alle live dabei sein konnten - vor ihrem Fernsehbildschirm.
Für Marshall McLuhan ist der Computer, dessen Anfänge er miterlebt und vielfach kommentiert hat, die höchste, koordinierende Instanz aller technischen Körperausweitungen, eine Erweiterung des Gehirns. 1964 formulierte er: „Wenn wir einmal unser Zentralnervensystem zur elektromagnetischen Technik ausgeweitet haben, ist es nur mehr ein Schritt zur Übertragung unseres Bewusstseins auch auf die Welt der Computer." (Understanding Media, S. 103 (1968), im englischen Original: „Yet such a condition would necessarily be an extension of our own consciousness as much as wheel is an extension of feet in rotation. Having extended or translated our central nervous system into the electromagnetic technology, it is but a further stage to transfer our consciousness to the computer world as well.“) Als weitere Körperausweitung würde der Computer Aufgaben des menschlichen Gehirns übernehmen. In dieser letzten Stufe der Entwicklung träte die Technik nun als komplettes Gegenstück des Menschen auf. Vergleicht man das Mediums Internet mit dem des Radios, wird man auf grundlegende Unterschiede stoßen: Die, wie McLuhan sagte, „Grammatik des Radios“ beruht auf Sendeschienen. Täglich oder wöchentlich wiederholte Programmabläufe, die von stündlichen Nachrichtensendungen rhythmisiert werden. Der Raum wird aufgehoben, Radio ist überall und nirgends, aber die zentralistische Zeitstrukturierung wird durch das Radio auf die Spitze getrieben. Für die Menschen, die dieses Medium schafft, hat Trendbüro Hamburg eine Bezeichnung aufgegriffen: Die Ich-AG. Der Mensch lebt nicht in einer sozial oder biografisch gewachsenen Kommunikationsgemeinschaft, sondern wird zu seiner eigenen Ego-„Firma”, die kommunikativ investiert oder bei Anzeichen der Krise ihre Investments zurückzieht. McLuhan formulierte eine Utopie, in der jeder Menschen als potentieller Künstler erscheint: Arbeit als Lebensinhalt wird durch Wissen und Lernen abgelöst. Der Mensch als Künstler arbeitet nicht mehr, sondern er erschafft, „denn die Technik verhilft ihm zur Realisation seiner geistigen Produkte und macht den Menschen wirklich frei". siehe dazu auch meinen Blog-Text: Lit.:
|