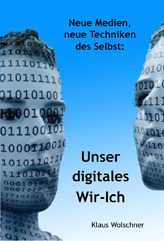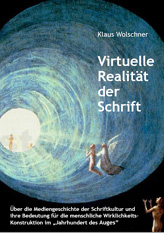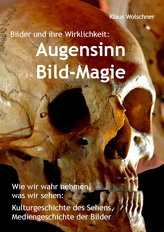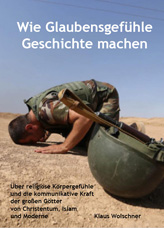|
Wir konsumieren, also sind wir Der „Konsumismus“ ist der Geist unserer modernen Welt geworden. 2024 Die Evolution des Nahrungs-Konsums ist ein Schlüssel zu der kurzen Geschichte der Menschheit (Yuval Harari). Die „neolothische Revolution“, die Sesshaftwerdung der Jäger und Sammler, gilt als Ursprung eines materiellen Überflusses, der letztlich zur Voraussetzung für die kulturelle Evolution wurde. In den modernen westlichen Gesellschaften hat sich in den letzten drei Jahrhunderten die Bedeutung des Konsums für die individuelle und die gesellschaftliche Identität noch einmal qualitativ gewandelt. Konsum ist nicht mehr Notdurft, sondern Überfluss für alle. Die Verfügung über den Überfluss ist nicht mehr Basis von Herrschaft, Überfluss kommt – wenn auch in differenzierter Weise – allen zugute. Die Traumbilder sind viel größer als die Produkte, für die sie werben. Die Produkte werden aus Tabak, Plastik oder Mehl gemacht, die Traumbilder aus Kommunikation – vermittelt über Medien. Von den Produkte haben wir eigentlich genug, von den Traumbildern nie - sie sind es, die wir begehren, wenn wir „shoppen“, zappen oder doomscrollen. „Konsum“ in einem erweiterten Sinne, der kulturelle Phantasien und Freizeit-Vergnügen einschließt, ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis moderner Gesellschaften geworden. Autoren wie Norbert Bolz haben das Zeitalter des „Konsumismus“ ausgerufen mit der Hypothese, dass alte und religiöse nationale Rivalitäten durch die Gemeinsamkeiten des Konsums überwunden werden könnten – wenn die Bedeutung des individuellen Konsums andere Identifikationskonstruktionen verblassen lässt. Gesellschaften sind komplexe Gebilde, wer sie „auf den Begriff“ bringen will, muss vereinfachen. Mit dem Begriff „Konsumgesellschaft“ soll herausgestrichen werden, dass Konsum eine eminent wichtige Rolle spielt. Er grenzt die Konsumgesellschaft ab von der der feudalen „Ständegesellschaft“ und von der „Klassengesellschaft“. Ebenso markiert „Konsumismus“ in provokanter Weise den großen Unterschied zum „Kommunismus“ – nicht mehr die Utopie einer konfliktlos geordneten Arbeitsgesellschaft beherrscht die Köpfe, sondern die Utopie des Konsums. Kaum jemand spricht noch von der „Humanisierung der Arbeit“, kaum eine Belegschaft der realsozialistischen Länder hat ihren „ihren“ vergesellschafteten Betrieb verteidigt. Kein Herrscher, auch kein Autokrat, kann es sich leisten, die Konsumbedürfnisse seines Volkes zu ignorieren. Konsum und Identität Als „Konsumismus“ hat Steven Miles 1998 die moderne Lebensweise („Way of Life“) bezeichnet. Das Konsumieren ist zum wichtigsten Lebenssinn geworden. Es geht nicht nur um den effektiven Verbrauch von nützlichen Gegenständen, sondern vor allem um die Konsumwunsch-Träume und Konsumverzicht-Ängste. Sicher wird noch gearbeitet, manche lieben sogar ihren „Job“. Man hat weiterhin Familie, Freunde, Bekannte. Viele sind politisch interessiert in dem Sinne, dass sie informiert sein und unter Freunden diskutieren wollen. Wenige sind aktive Mitglieder einer Partei oder Kirche. Die gemeinschaftlichen Bindungen sind nicht verschwunden, aber in ihrer Bedeutung für das individuelle Selbstverständnis verblasst. Natürlich gibt es in Zeiten der dominanten Konsumgesellschaft Menschen, die ihre Identität aus ihrer Arbeit beziehen können, aber für die meisten hat die (Lohn-)Arbeit an Bedeutung verloren, das Interesse der meisten Arbeitenden konzentriert sich auf die Freizeit und die Kaufkraft des Lohnes, es sind Freizeit-KonsumentInnen. Wenn Menschen über sich erzählen, erzählen sie von ihren Hobbys, ihren Reisen, eben ihrer Freizeit und selten von ihrer Arbeit. Natürlich gibt es noch den Produktionsstolz der Facharbeiter ebenso wie den Stolz der Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker, die so etwas wie Selbstverwirklichung durch Erwerbsarbeit empfinden können. Entscheidend für das Selbstverständnis sind die Erlebnisse, die Urlaube, die Partys, die Filme, neuerdings die digitalen Spiele. Und obwohl sich die meisten Menschen in ihrer Patchwork-Identität höchst individuell vorkommen, ähneln sich die Identitätskonstruktionen. Konsum erscheint uns individuell, ist aber sozial. Kein Produkt in den Tempeln des Konsums ist ein Unikat. Kein Wunsch kommt aus dem Nichts in uns, Wünsche kommen aus den Bildern, die wir sehen. Selbstverwirklichung gibt es nur im „Wir“ der Nachahmung. Die Bilder und die Muster des individuellen Konsums liefern die Massenmedien. Die Filme – in der Tradition der Romane des 18. Und 19. Jahrhunderts - liefern sogar die Muster der wahren Liebe. Die Partner gibt es online im Abo bei LemonSwan (Starterpaket 139,95,- Euro, dann mtl. 38,90 Euro) oder Parship (54,90 Euro. mtl. bei Jahres-Abo) Konsumismus schlägt Kommunismus Die Idee des Kommunismus war eine starke Idee in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Hoffnung, die alte Sehnsucht nach Gemeinschaft könnte neu verwirklicht werden, stand hinter sozialistischen Bewegungen. Sie beflügelte aber auch konservative Revolutionäre wie Oswald Spengler und den Nationalsozialismus. Aber am Ende des Jahrhunderts zeigt sich, dass die eigentliche Triebfeder der Geschichte der Wille zum Konsum. Und zwar ein Konsum, der nicht nur das Lebensnotwendige befriedigt, sondern der mit seinen Träumen und Wünsche dank der Kulturindustrie auch die Imaginationen und die imaginäre Freiheit beflügelt. Kern der kommunistischen Idee ist der Gedanke, auf Grundlage einer kollektiven Organisation der Arbeit müsse sich eine neue Gesellschaft planen und steuern lassen. Diese Idee ist mit dem „realen Sozialismus“ im 20. Jahrhundert ausgerechnet am realen Konsumismus der Massen gescheitert. Das Regime der DDR konnte die Grundbedürfnisse einigermaßen befriedigen, aber im Systemvergleich eben zu wenig. Und es war grau, es fehlte die Farbe. Es fehlte die Kultur des Begehrens, die im Westfernsehen täglich vorgeführt wurde. Am Ende verteidigten die Arbeiter den Sozialismus nicht, auch nicht in Polen oder in Jugoslawien. Nicht in China. Intellektuelle tun das, was ihre Rolle ist - sie überhöhen die Not derer, die sich mit ihrer materiellen Armut abfinden sollen oder müssen, mit großen Ideen. Freiheit oder Sozialismus, Diktatur oder Demokratie, Gemeinsinn oder Eigensinn - das waren die großen Alternativen, nach denen die Menschen der modernen Gesellschaften im 20. Jahrhundert ihre Geschichte machen sollten. Die Muster, mit denen den Menschen ihre Welt erklärt wurde, hatten etwas dichotomisches, es ging um gut oder böse. Solche „Horizontbegriffe“, wie Albrecht Koschorke sie nennt, haben eine große Faszination, weil sie etwas scheinbar Konkretes benennen und mit einer großen Weltformel überspannen. Abstrakte Horizontbegriffe schaffen Eindeutigkeit, zumindest im Kopf. Zu kompliziert ist die Wirklichkeit, in der der Herr immer auch „Knecht“ seines Knechtes ist und in der mit Gemeinsinn ohne Eigensinn kein Staat zu machen ist. Und nur mit Eigensinn ohne Gemeinsinn hält keine Gesellschaft zusammen. Der Medienwissenschaftler Herbert Bolz hat in provokanter Weise in seinem „konsumistischen Manifest“ vertreten, dass der rote Faden der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht der „Kommunismus“, sondern „Konsumismus“ war. Die Konsum-Wunschträume und die Konsum-Verzichtsangst sind die eigentlichen Triebfedern der Geschichte. Der Versuch, eine neue Gesellschaft auf Grundlage einer kollektiven Organisation der Arbeit zu errichten, ausgerechnet die kommunistische Idee ist im 20. Jahrhundert am realen Konsumismus der Massen gescheitert. Medien-Konsum Beim „Konsum“ geht es um mehr als die Befriedigung von „wirklichen“ materiellen Bedürfnissen. So wie die Identifikation mit der Nation schwache Individuen stark macht, so macht die virtuelle Aneignung von Konsumgütern reich. Der Medienkonsum wurde im 20. Jahrhundert zur wichtigsten Freizeit-Beschäftigung. Der Begriff der Freizeit hatte im 19. Jahrhundert Karriere gemacht – während gleichzeitig die Bedeutung der Arbeit für die Identität vieler Menschen abnahm. Freizeit wurde zum Merkmal der Lebensqualität und gilt inzwischen als Raum der persönlichen Freiheit, in dem die Menschen ihre Lebensstile entwickeln und sich im Konsum und in der Teilhabe am sozialen Leben selbst verwirklichen wollen. Konsum und Frauen Shopping wurde im 19. Jahrhundert zum beglückenden Erlebnis, als die Frauen durch Warenhäuser flanieren konnten, die mit ihrer palastähnlichen Architektur beeindruckten und in denen Waren ausgestellt waren, die die Flaneure bewundern, aber nicht kaufen wollten. In ihrer Imagination wurde die Kundin zur Königin. Die Geschichte des Konsums ist auf das Engste mit der der Emanzipation der Frauen verbunden. Mode-Journale waren im späten 18. Jahrhundert die ersten Illustrierten, die europaweit die Sehnsücht der schönen Reichen prägten. Das Warenhaus – von Emil Zola als „Paradies der Damen“ berühmt gemacht – öffnete dann die Zauberwelt des Konsums für die unteren weiblichen Schichten. Während die Männer noch ihre Identität in der Arbeit suchen konnten, begannen die Frauen sie im Konsum zu finden. Ein Blick zurück: Gottesmahl Schon die archaische Esskultur hatte eine transzendente Wir-Ebene. In der Sorge um das „tägliche Brot“ bewährte sich die Gemeinschaft der Sippe und spirituelle Gemeinschaften kannten verschiedene Formen des „Gottesmahles“: Das wertvolle Fleisch wurde vor der Verteilung an die Mitglieder der religiösen Gemeinschaft den jeweiligen Göttern „geopfert“. Verbreitet war auch die Vorstellung, die Götter würden teilnehmen an dem Mahl. Daran erinnert das Kindergebet „Komm Herr Jesus sei unser Gast“. In dem Göttermahl konnten die Teilnehmer die Gemeinschaft mit den Göttern sinnlich spüren, oft durch Drogen unterstützt. Im Kult um die Haare der Götter begegnen sich das Sakrale und das Banale. Das Göttermahl war eine heilige Feier, in der das „Wir“ als transzendente, unhinterfragbare Einheit gefeiert wurde. In der Geschichte der christlichen Kirche hat sich das alte Göttermahl abgespalten als eine rein symbolische heilige Feier der Einheit mit den Göttern. Der Luxus erschien in den Kathedralen der Transzendenz als Kulisse, als visueller Reichtum und Macht-Inszenierung. Daneben gab es die profanen Feiern des Essens und Trinkens in der distinguierten Form des adeligen Gelages, den konsumistischen Hofstaat (Norbert Elias) und in der populären Form des karnevalistischen und Volksfestes. Der Alkohol begleitete die Reise ins Paradies für die armen Leute. An den religiösen Feiern des Gottesmahles durften die einfachen Gläubigen nur visuell schauend teilnehmen, der Wein als Sinnbild das Opferblut ist den Priestern vorbehalten. Für das Volk wurde um die Kirche herum der „Kirchtag“ (Kirtag) organisiert – eine Dorffest und Jahrmarkt an dem letzten Tag der Woche, dem göttlichen Ruhetag. Wenn die Spottgedichte über die sexuellen Ausschweifungen und Festgelagen der Mönche über Jahrhunderte populär waren, kamen darin sicherlich auch die Phantasie des Volkes zum Ausdruck. Die Geburt der Konsumgesellschaft In der Konsumforschung wird die „Geburt“ der Konsumgesellschaft in den Niederlande des 17. Jahrhunderts und in der italienischen Renaissance verortet. Den profanen, nicht in kirchliche Sinnstiftung eingebundenen Konsum gab es immer schon an den Höfen der Herrscher und dann in den begüterten Bürgerhäusern. In der norditalienischen Handelsstadt Venedig wurde im 15. Jahrhundert das Marzipan erfunden. Aus dem Friaul bezogen die Venezianer die Mandeln, über das Mittelmeer kam der damals noch teure Zucker. Die Republik Venedig dominierte in der Renaissance auch den Handel mit Pfeffer und anderen feinen Gewürzen, mit Parfümen oder mit der indischen Seide. Das Verhältnis zwischen Konsum-Begehren und industrieller Entwicklung beschäftigt die Historiker seit einigen Jahrzehnten auch im Hinblick auf die industrielle Revolution Europas. Vor der industriellen Revolution hat es im 17. Jahrhundert eine Konsum-Revolution gegeben, hat der englische Historiker Neil McKendrick festgestellt. Zunehmender Konsum und insbesondere die Kommunikation von Objekten der konsumistischen Begierde haben eine Revolution des Fleißes bewirkt, stellt Jan de Vries fest: Eine zunehmender Teil der Bevölkerung war nicht mehr zufrieden mit der überkommenden Lebensweise, sondern arbeitete mehr, um sich mehr leisten zu können, neue Genussmittel wie Kaffee und Tee, Stoffe aus Indien, Schriften über das, was außerhalb des tradierten Horizontes zu entdecken war. Diese neue Neugier hat zu einer kulturellen Blüte schon in Venedig und in den Niederlanden geführt, zur industriellen Revolution aber erst in England und dann in den Vereinigten Staaten von Amerika. In der frühen Neuzeit ist fast überall in Europa eine Zunahme von gehandelten Gegenständen sichtbar - selbst in kleineren Dörfern gab es modische Kleidungsstücke, Geschirr, Besteck, Tisch- und Bettwäsche, Fächern, Bücher oder sogar Uhren. Wohlhabende Kreise konsumierten Kaffee, Tee und Tabak – und Zucker. Mit der Verbreitung des Buchdrucks kamen Einblattdrucke und Journale auf den „Markt“, die über besondere Kleidung, Möbel und dekorative Dinge informieren und verbreiteten in Reiseberichten insbesondere aus Paris und London auch Abbildungen davon. Luxus-Verordnungen und Kleider-Vorschriften versuchten vergeblich, die Begierde nach dem neuen Geltungs-Konsum zu unterbinden. Noch im späten 18. Jahrhundert versuchte Friedrich der Große, durch „Kaffeeriecher“ den freien Kaffee-Konsum in Preußen zu unterbinden und ein staatliches Kaffee-Monopol durchzusetzen – vergeblich. Schon vor der industriellen Revolution des 18. Jahrhunderts gab es eine deutliche Steigerung der Nachfrage nach gehandelten Waren, allerdings nur bei den Reichen in den Städten, so dass es etwas überzogen wäre, das Phänomen ganz allgemein als „Konsumrevolution“ (Neil McKendrick) zu bezeichnen. Maxine Berg spricht von einer „Produktrevolution“ – eine große Zahl begehrenswerter Erzeugnisse, Dinge zur Erhöhung des „häuslichen Komforts", kam dank neuer Produktionstechniken preiswert auf den Markt. Baumwollstoffe, Porzellan, neue Möbel und auch Tee, Kaffee, Zucker oder Tabak verkörperten ein neues Lebens- und Glücksgefühl. Da ging es nicht mehr nur um das überlebensnotwendige Verlangen des Körpers, sondern um Bedürfnisse des Geistes – um das, was die Produkte versprachen. Man schmückte sich genauso mit dem öffentlichen („Geltungs-”)Konsum“ von gedruckten Journalen. Und die Menschen waren bereit, länger und intensiver für ihren Konsum zu arbeiten. Seit dem späten 17. Jahrhundert galten Konsumwünsche nicht mehr als Todsünde („Luxuria“), der Konsum erfuhr eine moralische Neubewertung. Konsum- und industrielle Revolution Die steigende Nachfrage schuf die Voraussetzungen für die Ausweitung des Kolonialhandels und für kommerziell vertriebene Manufakturwaren. Dazu gehörten Uhren, Spiegel, Möbel, Teppiche, Keramik, Porzellan, Silber und Zinn, modische Kleidung wie Strümpfe, Seidenkleider, Taschentücher, Schirme, Fächer und eine Vielzahl von Stoffen und Geweben. Im späten 19. Jahrhundert wurde in Großbritannien, dem Vorreiter der Industrialisierung, eine Vielzahl von Lebensmitteln für den Durchschnittsbürger zugänglich, die zuvor von Brot und Kartoffeln gelebt hatte. Die neuen modernen Warenhäuser waren „Konsum-Paläste“ und lockten auch die ärmere Bevölkerung, die sich die Luxus-Waren oft nicht leisten konnte, mit der Zurschaustellung verlockender Produkte. Im deutschen Kaiserreich waren es vor allem die reichen Bürger, die im Konsum die Symbole für Geltung (Thorsten Veblen) und Lebensglück suchten. Im frühen 20. Jahrhundert eiferten mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung ihnen die Facharbeiter und Angestellten nach. Die deutsche hedonistischen Konsumenten verstanden sich aber - stärker als die amerikanischen – als Versorgungsberechtigte. Seit den Bismarckschen Sozialreformen entwickelten die Lohnarbeiter Ansprüche auf sozialstaatliche Sozialleistungen. Der Staat wurde verantwortlich für kollektive Güter wie die Wasser- und Elektrizitätsversorgung, für öffentliche Mobilitätsdienste und auch ein populäres kulturelles Angebot in den Städten. Das moderne mediale Konsumparadies Die moderne europäische Gesellschaft wurde im 20. Jahrhundert zur Konsumgesellschaft für alle. In „Amerika“, sprich den Vereinigten Staaten, hatte dieser Prozess früher und intensiver begonnen. Der Versandhandel stieg an, mehrstöckige Kaufhäuser lockten die KonsumentInnen mit den Produkten der Fließbandproduktion, die nützlichen Dinge waren selbstverständlich da und im Verständnis einer breiten Bevölkerung war „Konsum“ mit den Produkten einer Verlockungsmaschinerie verbunden. Nicht Reichtum oder politische und wirtschaftliche Macht wurden demokratisiert, sondern das individuelle Begehren. Konsum wurde zum Mittel, um Glück zu empfinden, der Geldwert zum Maß für Wert. Die Traumbilder des Konsums sind es, die das „amerikanische Jahrhundert“ des Massenkonsums unwiderstehlich gemacht haben. Wir haben die Bilder im Kopf: Traumfigur, Traumauto, Traumliebhaber am Traumstrand, Traumküche. Diese Kultur des Konsumvergnügens verändert die menschliche Subjektivität und Individualität. Dieser fiktive Charakter des Konsums zeigt sich vor allem in der Filmindustrie, die in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts in den Werkstätten der Tüftler erfunden worden war und nach dem Weltkrieg in „Amerika“ mit dem Hollywood-Kino zum weltweit dominierenden Muster für „Traumfabriken“ und „Filmpaläste“ wurde, in denen die Bilder von Jugend, Fitness und Schönheit geprägt wurden. Es gab erhebliche materielle Entwicklungen, am Anfang der 1920er Jahre verfügte ein Drittel der US-Haushalte über Strom, am Ende waren es zwei Drittel. Das ermöglichte nicht nur Licht, sondern auch Radios, Staubsauger und Kühlschränke. Die Zahl der Autozulassungen verdreifachte sich zwischen 1920 und 1929. Neue Drucktechniken machten die Zeitungen und Zeitschriften billig, Backmaschinen das Brot. Aber im Bewusstsein der Welt war der „American Way of Life“ weniger mit Henry Ford als mit Musik und Tanz verbunden. Die Vereinigten Staaten wurden zu einem medialen Konsumparadies, zu einem phantastischen Land der Möglichkeiten, verbunden mit der Hoffnung, dass jeder sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Die „goldenen Zwanziger“ In der Zeit der „Weimarer Republik“ kam der Konsumismus nach Deutschland. Dabei wechselten Perioden des Mangels und der Wirtschaftskrise mit solchen der Prosperität und der Wohlstandshoffnungen. Während die Intellektuellen von einer „Entzauberung der Welt“ sprachen, suchte das Volk den Zauber des Konsums und der Kulturindustrie. Die religiöse Rechtfertigung von Macht war verblasst, die nationale Identität im Krieg 1918 untergegangen - die Bevölkerung sah sich zum Souverän erklärt und verband damit den Anspruch auf persönliches Wohlergehen: Wählerstimmen gegen Wohlstands-Versprechen. Enttäuschte Konsum-Erwartungen waren dann auch entscheidend für die (ausbleibende) Identifikation mit der Weimarer Republik. Der „republikanische Relativismus“ und der Verrat der Intellektuellen Die bildungsbürgerlichen Intellektuellen konnten die 1920er nur Jahr als Krisenjahre schlechthin erleben und thematisieren. Für sie war der Zusammenbruch der gewohnten Ordnung ein Schock. Sie verglichen die junge Republik mit einem Wunsch-Bild vom stabilen, glanzvollen Kaiserreich. Und sie hatten Probleme damit, dass nicht „die Besten“ gewählt wurden – weil es die in einer Demokratie nicht gibt. Als „Krisen“ wurde wahrgenommen, dass Regierungen „wackeln“, abgewählt wurden etc. Die geistige Elite war nicht geistig vorbereitet auf die Demokratie und ihren Relativismus. Die Intellektuellen begleiteten die populistische Demokratie-Enttäuschung mit ihren nostalgischen Erinnerungen an die „Welt von gestern“ (Stefan Zweig). Die Theoretiker, die sich auf die neue, moderne Gesellschaft gedanklich eingelassen haben, werden bis heute nicht als die Intellektuellen ihrer Epoche wahrgenommen (Ernst Cassirer, Hugo Münsterberg, Hans Kelsen, Edward Bernays, Theodor Geiger). Hinzu kommt, dass in Deutschland in den 1920er Jahren die Meinungsbildung des Volkes zunehmend über Massenmedien stattfand. Nicht nur der alte Adel, sondern auch der bildungsbürgerliche „Geistesadel“, wie die Intellektuellen vorher manchmal bezeichnet wurden, hat die Bedeutung verloren, die er in vordemokratischen Zeiten hatte. Kinofilme waren gesellschaftlich wichtiger als Zeitgeist-Bücher. Als Krise musste der alte Geistesadel seine soziale Entmachtung erleben: „Öffentlichkeit“ war nicht mehr die Öffentlichkeit des „Geistesadels“, sondern die der neuen Massenmedien - Zeitungen, Illustrierte, Kinofilme. Das Unverständius der großen Geister für das niedere Volk reichte von Oskar Spengler bis Walter Benjamin, der demokratische Umbruch war nicht begleitet von einer Demokratisierung des Denkens. Man kann mit Thomas Hecken nur das „Versagen der Intellektuellen“ konstatieren, die in ihrem elitären Elfenbeinturm verharrten und den Untergang ihrer Welt betrauerten. 1933 – Hoffnung nur an den radikalen Rändern rechts und links? Da in den Wirtschaftskrisen die republikanischen Regierungen sich als hilflos darstellten, war das junge demokratische Weltbild diskreditiert. Was blieb, waren die politischen Kräfte, die ein schlichtes (unkompliziertes, klares) Weltbild anboten und die den Eindruck erweckten, sie würden diktatorisch „gut“ regieren - eben Kommunisten und National-Sozialisten. Als alle Konsum-Versprechen 1929 in der Weltwirtschaftskrise wieder einmal fundamental enttäuscht wurden, waren die Intellektuellen sprachlos. In der größten Krise gab es keine Krisendiskussion mehr, „Krise“ wurde zum propagandistischen Kleingeld. Die Masse der wahlberechtigten Bevölkerung spaltete sich in die Anhänger der kommunistischen und der national-sozialistischen Utopie. Beides waren krisenfreie Gesellschaftsentwürfe - antidemokratisch totalitär, angeblich im „Interesse des Volkes“. Beide Regimes beendeten die kontroverse, oft ratlose Diskussion über eine moderne demokratische und auf Zustimmung der Mehrheit angewiesene Gesellschaft. Die kommunistische Utopie war Ende der 1920er Jahre diskreditiert, die nationale schien unbelastet. Dass das deutsche Kaiserreich den Krieg verloren hat, war ein Schock für das alte Nationalbewusstsein gewesen. 1872 hatte sich der deutsche Kaiser in Versailles krönen lassen - eine Provokation für alle Franzosen – und dann hatten die Sieger in Versailles darüber verhandelt, wie sie das besiegte Deutschland niederhalten konnten mit unglaublich hohen Reparationsforderungen, die die wirtschaftliche Erholung Deutschlands verhindern sollten. "Revanche für Versailles!" war die Losung, die soziale Ziele in nationale einwickelte. So stand sogar die nationalsozialistische Dikratur, von Götz Aly deswegen „Hitlers Volksstaat“ und „Gefälligkeitsdiktatur“ genannt, unter dem Erwartungs-Druck, die schlechten Erinnerungen an Weimar und die Weltwirtschaftskrise erfahrbar zu überwinden. Mit der „Dolchstoß“-These war legendär, dass die Versorgungsengpässe im Ersten Weltkrieg die Zustimmung zur Kriegsführung unterminiert hatten. Das NS-Regime versuchte daher, seine Rüstungsanstrengungen mit dem Versprechen preiswerter Konsum-Güter („Volkswagen“, Volksempfänger, „Kraft durch Freude“) über die Zeit des Mangels zu retten. „Amerika“ Auf dem europäischen Kontinent war die Demokratie 1917 und 1933 gescheitert. Auch deshalb musste der Blick nach „Amerika“ faszinierend sein. Die USA hatten es geschafft, bei allen internen gesellschaftlichen Konflikten eine - auch militärisch - starke Nation zu bilden. Wohlstand Auch in England hatten weder Kommunisten noch National-Sozialisten bedeutenden Einfluss bekommen. Der zweite Anlauf zur modernen Demokratie ist verbunden mit den Namen John Maynard Keynes, Karl Popper, Ernst Fraenkel. Die konsumpolitischen Ordnungsentwürfe, die zumindest für die Zukunft mehr Freizeit-Konsum versprachen, waren die Hoffnungsträger der politischen Krisen-Kommunikation. Die in „Amerika“ so erfolgreiche Konsumkultur wurde zum Hoffnungsträger und Katalysator der deutschen Entwicklung. „Wirtschaftswunder“ In der Entwicklung der Konsumgesellschaft gibt es Ungleichzeitigkeiten. Frauen konnten sich früher als Männer als „Konsumentinnen“ definieren, weil sie weniger und seltener Arbeitsstolz hatten. Die intellektuellen Bürgerkinder, die alles hatten und Rechtsanwälte, Ärzte oder Politiker werden wollten, konnten sich mit der radikalen Konsumkritik identifizieren. Und doch wurde, aus deutscher Sicht, in den Jahrzehnten zwischen den goldenen „20er Jahren“ und dem Wirtschaftswunder der 1950er Jahre „Amerika“ zum großen Versprechen eines modernen Lebens mit verfassungsmäßig garantiertem Recht auf „Persuit of Happiness“. Diese Vision überwand den Antiamerikanismus der Nazis, das „Wirtschaftswunder“ versöhnte die Deutschen mit der Demokratie. Erst in der Nachkriegszeit seit 1949 schienen sich die Hoffnungen auf die Konsumgesellschaft in Deutschland stabil zu erfüllen. Politiker wie Ökonomen sprachen überrascht von einem „Wirtschaftswunder“, der CDU-Minister Ludwig Erhard propagierte die Idee des „Wohlstands für alle“. Bereits im Jahr 1953 stellte der Soziologe Helmut Schelsky fest, dass sich die alten klassenspezifischen Konsummuster aufzulösen begannen. Das betraf weniger den „Warenkorb“ als das Spektrum der Massen-Unterhaltung, vor allem Musik und Film. In der Tradition der Ablehnung der Kulturindustrie klagte Jürgen Habermas darüber, dass das Publikum vom „guten“ Räsonnement zum „schlechten“ Konsum regrediere. Das Fernsehen, von Habermas in seiner Analyse vom „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ noch 1962 ignoriert, hatte die Bühne für die Demokratisierung des Luxus bereitet. Die Deutschen haben sich mit dem „Wirtschaftswunder“ der 1950er Jahre mit der Demokratie angefreundet. Selbst das SED-Regime der DDR konnte sich dem Sog des Konsums nicht entziehen. Um dem Legitimationsverlust zu entgehen nahmen die realen Sozialisten Kredite beim Klassenfeind auf – bis 1989 die Staatspleite drohte und die die Bevölkerung der „Ost-Zone“ für den Anschluss an die westdeutsche Konsum-Demokratie demonstrierte. (3) Es scheint eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die linksradikalen Studenten der post-68er Jahre, satt vom Wirtschaftswunder, von einer „Alternativökonomie“ träumte, einem Stück Kommunismus mitten im Kapitalismus. Sie suchten Selbstverwaltung, Selbstentfaltung, ganzheitliche Arbeitsformen und zahlten den Preis, den die gewerkschaftlichen Kritiker „Selbstausbeutung“ nannten. Die Idee der Alternatividee war eher eine Farce auf die alte marxistische Kapitalismuskritik des 19. Jahrhunderts, auf jeden Fall nicht ansteckend. Der studentische Antiamerikanismus der 1960er Jahre ging einher mit hedonistischer Hippie-Kultur – einer Extremform des Konsumismus. Unter dem Stichwort „Amerikaner way of Life“ ist der „Konsumismus“ zum weltweit dominanten Gesellschaftsmodell geworden: Der Konsum wurde demokratisiert, also für fast alle zugänglich gemacht und zudem wurden über die Medien auch die Konsum-Phantasien bedient. In Deutschland war der Nationalsozialismus vielleicht ein letztes Aufbäumen - vom „American was of Life“ und dem Wirtschaftswunder wurde der nationalsozialische Mief in den 1950er Jahren hinweggespült. Während die intellektuelle Eliten, links wie rechts, den Konsum der Massen verachteten und für gutes Geld sich darüber Gedanken machen, wie sie die „Massen“ zu einem vernünftigen politischen Engagement erziehen könnten, hält es die große Mehrheit der Bevölkerung eher mit Benjamin Constant: „Der junge Mann glaubt, dass er sein Land mehr liebt als seine Familie und manchmal die Welt mehr als sein Land. Aber mit zunehmendem Alter verengt sich der Horizont seiner Gefühle“, wusste Benjamin Constant im Jahre 1819, „mit zunehmendem Alter der Menschheit (treten) häusliche Zuneigungen an die Stelle großer politischer Interessen. Man muss sich also die politische Freiheit so billig wie möglich erkaufen“. Politisches Engagement geschieht aus Not, nicht aus Passion. Die Jahre des deutschen „Wirtschaftswunders“ waren in diesem Sinne ein Modell – die Menschen gaben einmal in vier Jahren ihre Stimme ab und waren in ihrer Mehrzahl zufrieden damit, dass ihr Engagement für die „häuslichen Zuneigungen“ ihnen ein angenehmes Leben versprachen. Globalisierung des Konsumismus? Die mediale Globalisierung trägt die Bilder von den westlichen Konsum-Tempeln bis in die ärmsten Regionen Afrikas und Asiens. In den bevölkerungsreichen Ländrn Asiens wächst eine Mittelschicht, die sich am amerikanischen und europäischen Konsum, in Afrika nähren die Bilder vom europäischen Reichtum eher die Bereitschaft zur Migration. In Japan beobachtgen Soziologen die problemlose Vermischung traditioneller japanischer Werte mit modernen, westlichen Ansprüchen. Die entwicklung der Konsumgesellschaft in China wird das 21. Jahrhundert entscheidend prägen. China hat schon heute (2024) den größten nationalen Verbrauchermarkts der Welt. Dabei hatte Maos „Großer Sprung nach vorn“ China zurückgeworfen in die Zeiten der Hungersnöte. Paradoxerweise hat die „Ein-Kind-Politik“ eine Generation von Menschen hervorgebracht, die von ihren Eltern in einzigartiger Weise verwöhnt wurden – die sogenannten „Singletons“. Sie gelten als kühn, individualistisch, egozentrisch, einsam und materialistisch und verkörpern die neue konsumistische Lebensphilosophie. Die chinesische Mittelschicht umfasst mehr Menschen als die aller europäischen Staaten zusammen. China ist gleichzeitig eine der digital führenden Nationenen, China ist der größte E-Commerce Markt der Welt. China ist eine Mobile-First-Gesellschaft, die die soziale Entwurzelung durch Vergemeinschaftung in Online-Foren und Neo-Tribes kompensiert. Die Größe des chinesischen Marktes und die wirtschaftliche Abhängigkeit des Konsums in Europa und den USA lassen erwarten, dass der chinesische Konsumismus global einen großen Einfluss haben wird. Dass es in den asiatischen Ländern spezielle kulturelle Traditionen gibt, die den globalen Konsumismus nachhaltig prägen können, ist bisher nicht erkennbar. China ist ein dabei besonders spannendes Fallbeispiel für den Konsumismus. Der Staat hat seine kommunistische Terminologie nicht aufgegeben, sondern als schlichte Rechtfertigung eines diktatorischen Regimes auf seinen Kern reduziert. Gleichzeitig hat sich in China eine industrielle Revolution entfaltet, die nicht nur eine Milliarde eigener Konsumenten, sondern darüber hinaus den Weltmarkt mit preiswerten Konsumgütern versorgt. Nicht lange vorbei sind die Zeiten, in denen China als „Entwicklungsland“ aus europäischer Sicht neben Afrika stand. Die große Zukunftsfrage ist, ob das chinesische Engagement in Afrika dort die industrielle Dynamik exportieren kann, die der europäischen „Entwicklungshilfe“ trotz großer Anstrengungen versagt geblieben ist. Bisher können die afrikanischen Ökonomien die Konsumgüter, die die Bevölkerungen begehren, nicht selber produzieren oder bezahlen, was zu dem Flüchtlingsstrom führt, der die europäischen Länder überfordert und sozialpolitisch destabilisiert. Der „Konsumismus“, behauptete Bolz, also in dem entfesselten Konsum-Begehren, sei die Triebkraft der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und einzig in der Herrschaft des Konsumismus liege die Hoffnung, den religiösen, nationalistischen oder rassistischen Hass zu überwinden - der Konsum mache alle gleich. Chinesische, russische und amerikanische, arabische und europäische Jugendliche lieben dieselben Handys, McDonalds und Jeans. Das war damals mutig formuliert, im Jahre 2002 kurz nach dem furchtbaren islamistischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York, und eine große Hoffnung. Sehr mutig bleibt die These von Norbert Bolz, dass nur der Konsumismus die ideologisch und machtpolitisch festgefahrene Feinschaft zwischen Islamisten und Juden überwinden könnte. Nach wie vor gibt es keine andere Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz zwischen den Ideologien. Politisch-moralischer Konsum – neuer Luxus der Reichen? Das Jahrhundert des hemmungslosen Konsumismus scheint zuende zu gehen, aktuelle Konsumentenbedürfnisse sind durch einen Wertewandel geprägt. Ressourcenschonende Produktion nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Konsum ohne postkoloniale Ausbeutungs-Strukturen sind die Grundideen eines moralischen Konsums. Traditionelle Werte wie Besitz, Wachstum und Prestige rücken in den Hintergrund. Allerdings sind alle diese konsumkritischen Motive gespeist von einem anderen Konsum, sie sind keine Alternative zum Konsum. Und sie sind ein Phänomen des matieriellen Reichtums, auf dessen Grundlage man sich die Moral leisten kann. „Degroth“ oder: Wirtschaftswunder-Demokratie in der Krise Die Frage stellt sich, wie die an den konsumistischen Optimismus gewöhnten Menschen auf Krisen der realen Welt reagieren - oder auf die Sorge, dass es nicht immer nur aufwärts gehen kann. Die um sich greifende Politikverdrossenheit scheint anzuzeigen, dass vor allem andere - und das wäre dann „der Staat“ - verantwortlich gemacht werden für den Vertrauensverlust des Konsumismus. Verglichen mit dem Wohlstand in der Welt sind es kleine Sorgen, die in der Vertrauenskrise der reichen westlichen Welt große Auswirkungen haben. Die Menschen sind es nicht gewohnt, für ihren Wohlstand zu kämpfen. In den medialen Selbstbildern kam mühevolle Arbeit nicht mehr vor, in den angeblich „sozialen“ Medien geht es und Freizeit und um das Genießen des träumend Produzierten. Die Träume kennen zudem keine Kompromisse, sie sind genuin demokratiefeindlich. So ist es nur konsequent, wenn die enttäuschten Konsumisten ihre verzweifelte Hoffnung auf einen personifizierten Allmächtigen projizieren, einen Parteiführer, der wie der österreichische Populisten-Führer Herbert Kickl (2024) auf Wahlplakaten verspricht: „Euer Wille geschehe“. Der sozial-liberal-grünen Fortschrittsoptimismus, der die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts dominierte, zerfällt mit der Erfahrung gebremsten Wirtschaftswachstums. Die alten intellektuellen Selbstbeobachter der Gesellschaft, die die akademischen Institutionen linksliberal besetzt halten, nehmen die enttäuschten Konsumisten nicht ernst, sondern ärgern sie zusätzlich mit Gender-Fragen, „Wir schaffen das“-Parolen und Vorträgen über die ökologische Notwendigkeit von „Postwachstum“ und „Degroth“, sprich Konsumverzicht. Konservative und konservativ-populistische Wahlvereine triumphieren und die linksliberalen Intellektuellen verstehen nicht, warum. Digitaler Konsum Alle pädagogischen Bemühungen sind ins Leere gelaufen, „die Menschen“ zu einem vernünftigen politischen Verhalten zu erziehen, zur Abkehr von den Rattenfängern populistischer Verschwörungstheorien zu motivieren oder auch nur zum rechten Umgang mit den neuen Medien. „Die Menschen“ hören einfach nicht zu, wenn Jürgen Habermas ihnen den herrschaftsfreien Dialog erklärt, sie vergnügen sich unter der Bank beim „doomscrolling“. „Der gesteigerte Konsum vornehmlich negativer Schlagzeilen kann gesundheitsschädliche psychophysiologische Folgen haben“, erklärt uns Wikipedia unter dem Stichwort „Doomscrolling“. Wisch und weg. Was die alten Wortführer in den alten Medien sagen, ist in den Wind geredet. Die sozialen Medien haben ihre eigenen, neuen Influencer. Und die Selektionskriterien für erfolgreiche Influencer sind die der Konsumgesellschaft, nicht die eines demokratischen Diskurses. Die alte Parteiendemokratie funktionierte offenbar auf der Grundlage der alter hierarchischen Medien-Struktur, es gab wenige „Sender“, von den herrschaftsfreien Diskurs erklärten, aber den Sender beherrschten und mit den Parteienelite in jeder Weise verbunden waren. Die Empfänger sollten sich im Wahlakt als mündige Staatsbürger empfinden. Diese Kommunikations-Macht und die damit verbundene Parteiendemokratie zerfallen mit den neuen Medien. Wie Demokratie funktionieren soll, wenn die letzte Zeitung ihre „Print“-Ausgabe eingestellt hat und aufgrund der „online-umsonst“-Mentalität ihre professionellen Journalisten dezimieren muss, weil derzeit niemand. Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk verschlingt Milliarden an Gebühren und verbaut sich gleichzeitig mit dem Verbot der „Presseähnlichkeit“ und der „Depublikationspflicht“ seine digitale Zukunft - er verzichtet darauf, presseähnliche Angebote im Internet, dem Medium der Zukunft, zu machen und mit seiner über Jahrzehnte gewachsenen Kompetenz ein Wissens-Archiv in den Mediatheken und über ein professionell journalistisch kuratiertes Youtube anzubieten. Der Konsumismus des 21. Jahrhunderts wird digital. „Zusammen allein“ (Arlt Hochschild) ist die Kultur der mehr digital als real kommunizierenden Menschen. Der Konsum verlagert sich in die Welt der digitalen Medien. Dort findet das digitalisierte Individuum seine Freunde und seine Freude. Im Netz und in den „sozialen Medien“ kann man ungestört träumen und fürs eigene Ego Bestätigung holen. In einem neuen Medium ist die Zerstörung des alten gesellschaftlichen Gefüges schon angelegt, hat Marshall McLuhan hellsichtig erklärt: „Denn die ‚Botschaft‘ jedes Mediums oder jeder Technik ist die Veränderung des Maßstabs, Tempos oder Schemas, die es der Situation des Menschen bringt.“ Der Maßstab der menschlichen Umwelt wird mit der digitalen Technik global, es gibt keine Ent-fernung mehr. Und keine als etwas Besonders empfundene Nähe. Keine Heimat, keine selbstverständliche, gewohnte Lebens-Umwelt. Die Erfahrung der Stadt an der Wende zum 20. Jahrhundert, in der jeder jedem fremd ist, wird auf globaler Ebene wiederholt bzw. weitergedreht. Aber in der Stadt gab es die Chance, kulturelle Nachbarschaften mit körperlicher Nähe und intensiver Kommunikation zu bilden. Die digitale Lebens-Umwelt ist schwerelos und körperlos. Und das Tempo ist atemberaubend. Das um sein natürliches „Wir“ beraubte „Wir-Ich“ kann sein Spiegelbild nur als narzistisches Ich wahr-nehmen. Die animalische Körperlichkeit kommt nicht mehr mit, wenn das digitale Ich seine Höhenflüge antritt. Das narzistische Ich will den Körper beherrschen, aber es kommt nicht los von ihm. Das Selbstbild scheitert immer wieder an der Schwerkraft – und ist schließlich verdammt dazu, sich zu arrangieren. Bilder dienen der symbolischen Selbst-Vergewisserung. In vormodernen Zeiten gab es nur wenige Bilder im Kopf, die immer wieder betrachtet werden konnten: Das Haus, die vier Wände, die Familie, den Gekreuzigten, den Kirchturm und den Horizont. Es waren innere Bilder der Gemeinschaft. Nur die Reichen konnten sich ein Portrait malen lassen. Angesichts der Techniken der Reproduktion von Abbildungen wurde im 19. Jahrhundert schon über die „Bilderflut“ geklagt. Dabei symbolisierten in analogen Zeiten die wenigen der Erinnerung verfügbaren Bilder immer noch eine gemeinsame Wirklichkeit und wurden in Familien-Alben gesammelt. Erst die Selfies auf den Handys sind fast ausnahmslos „Ich-Bilder“. Die neuen „sozialen“ Medien sind Bilder-Medien, in der Kultur der Selfies spiegelt sich das Ich scheinbar mühelos. In der Kulturkritik wird viel darüber geschrieben, dass die Kultur des diskursiven Textes verloren geht in der schönen neuen medialen Bilderwelt. Aber das ist eine Klage der Bildungsbürger. Die Mehrzahl der Menschen hat auch früher keine diskursiven Texte gelesen und viele Postkarten, aber kaum Briefe geschrieben. Der Konsum hat sich auf das Internet, das für den Erlebniskonsum neue Dimensionen eröffnet. „Schaufensterbummel“ finden in öffentlichen Verkehrsmitteln statt - in Online-Shops. Die digitalen Kommunikationstechnologien halten immer etwas Verlockendes bereit, das nur einen Download entfernt ist. Immer gibt es etwas etwas, das interessaner, amüsanter oder beeindruckender ist als das Alltagsleben um einen herum. FOMO, „Fear of missing out“, ist allgegenwärtig. Das ereignisreiche und kreative digitale Leben steht in der Konkurrenz zu den Routinen des Alltags.
siehe auch meine Blogtexte zum Themenbereich
|